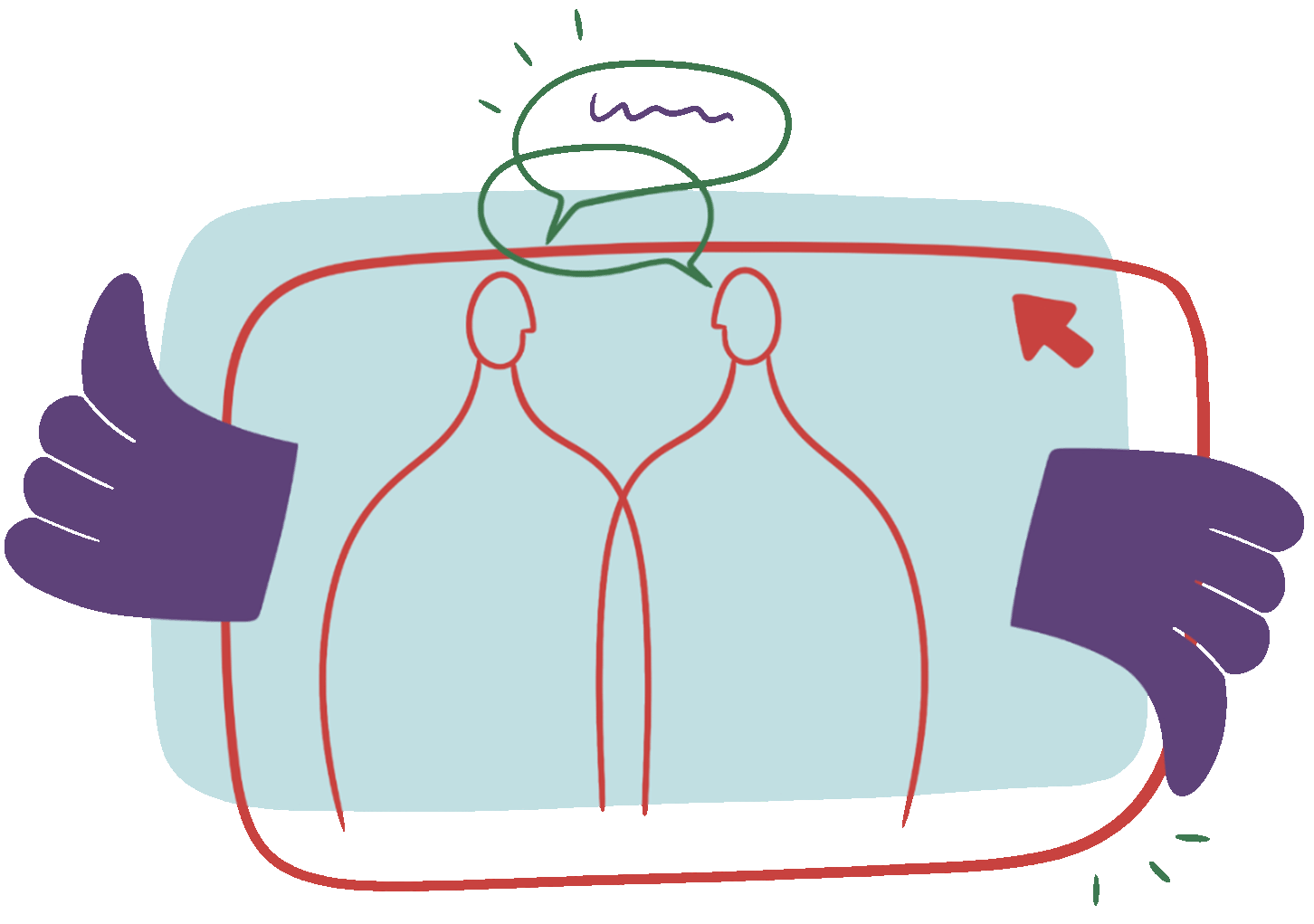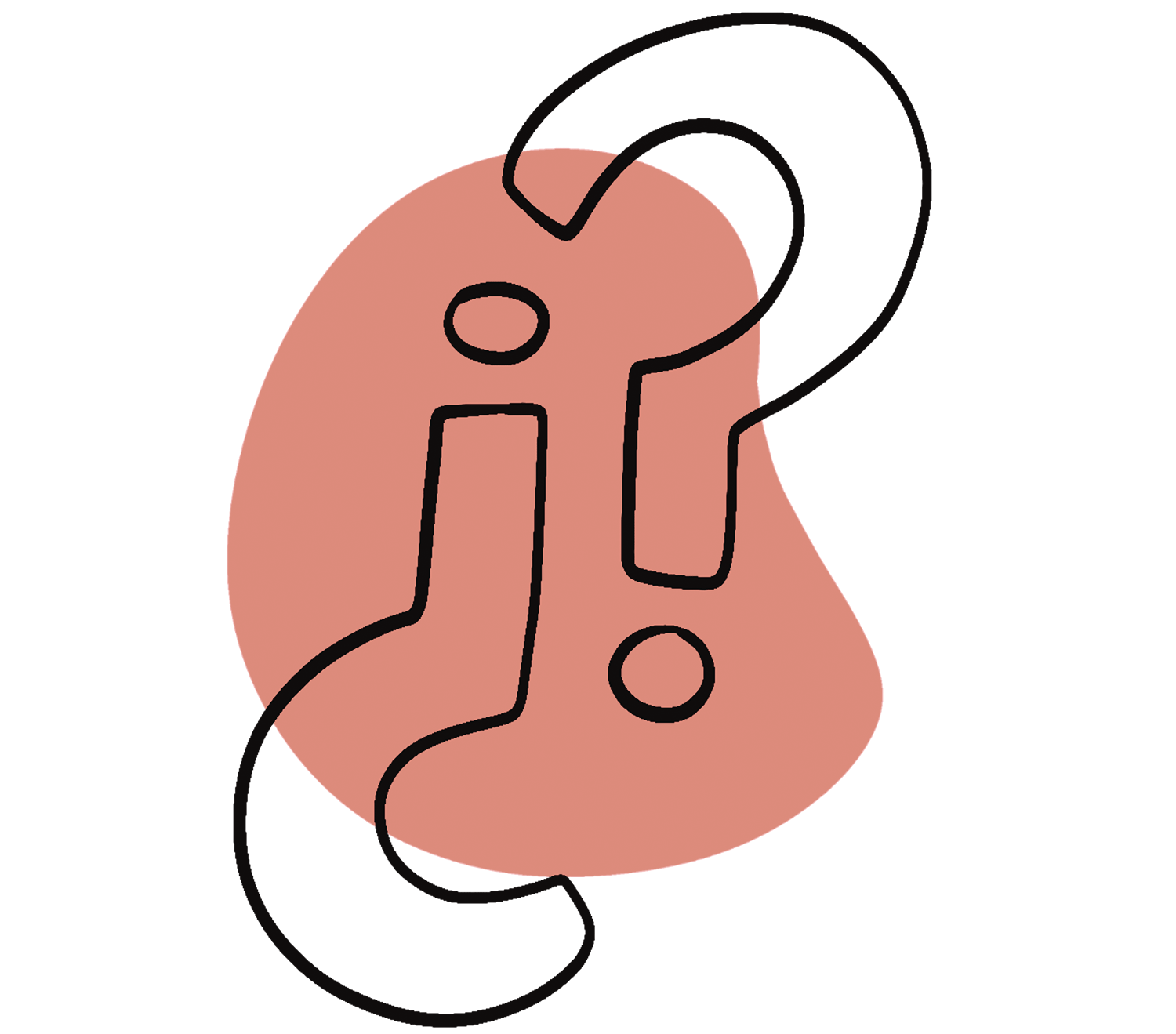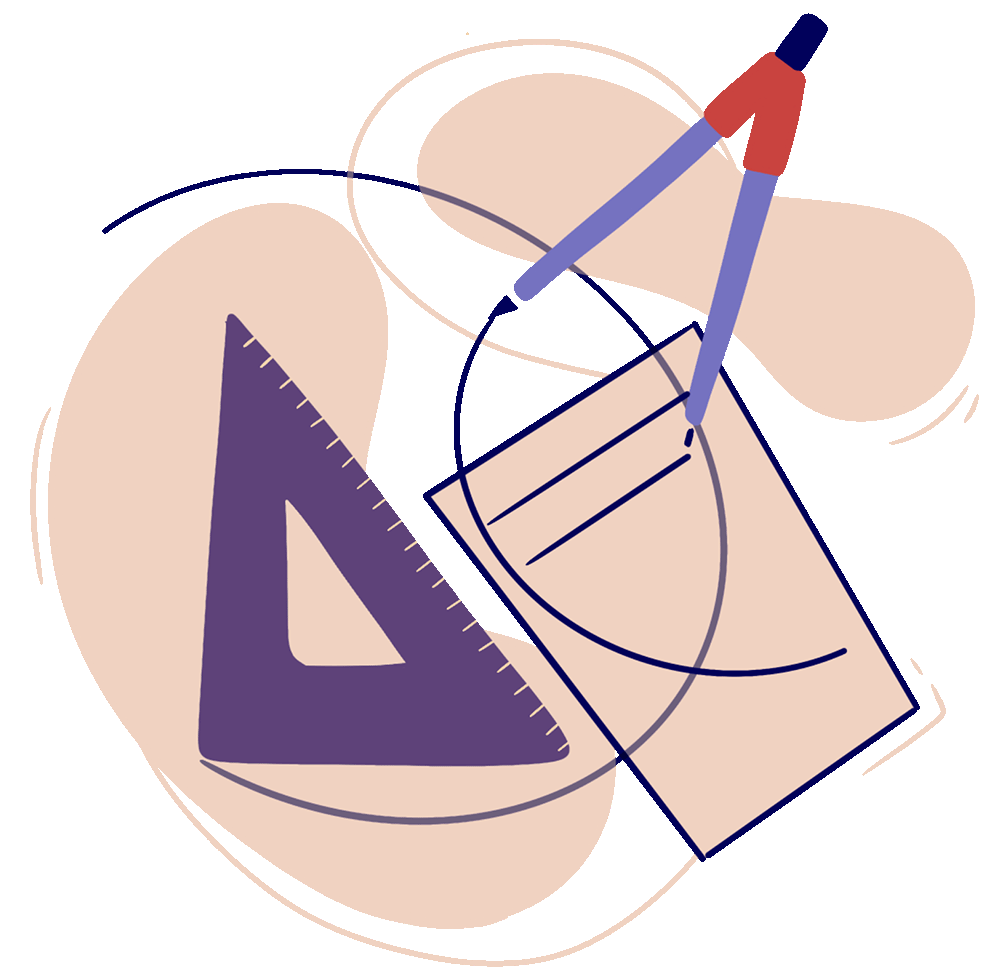Dies gilt auch für Übersetzungsprogramme oder Chat-GPT.
Prinzipiell sollten nur solche Quellen zitiert werden, die auch von anderen gelesen und überprüft werden können.
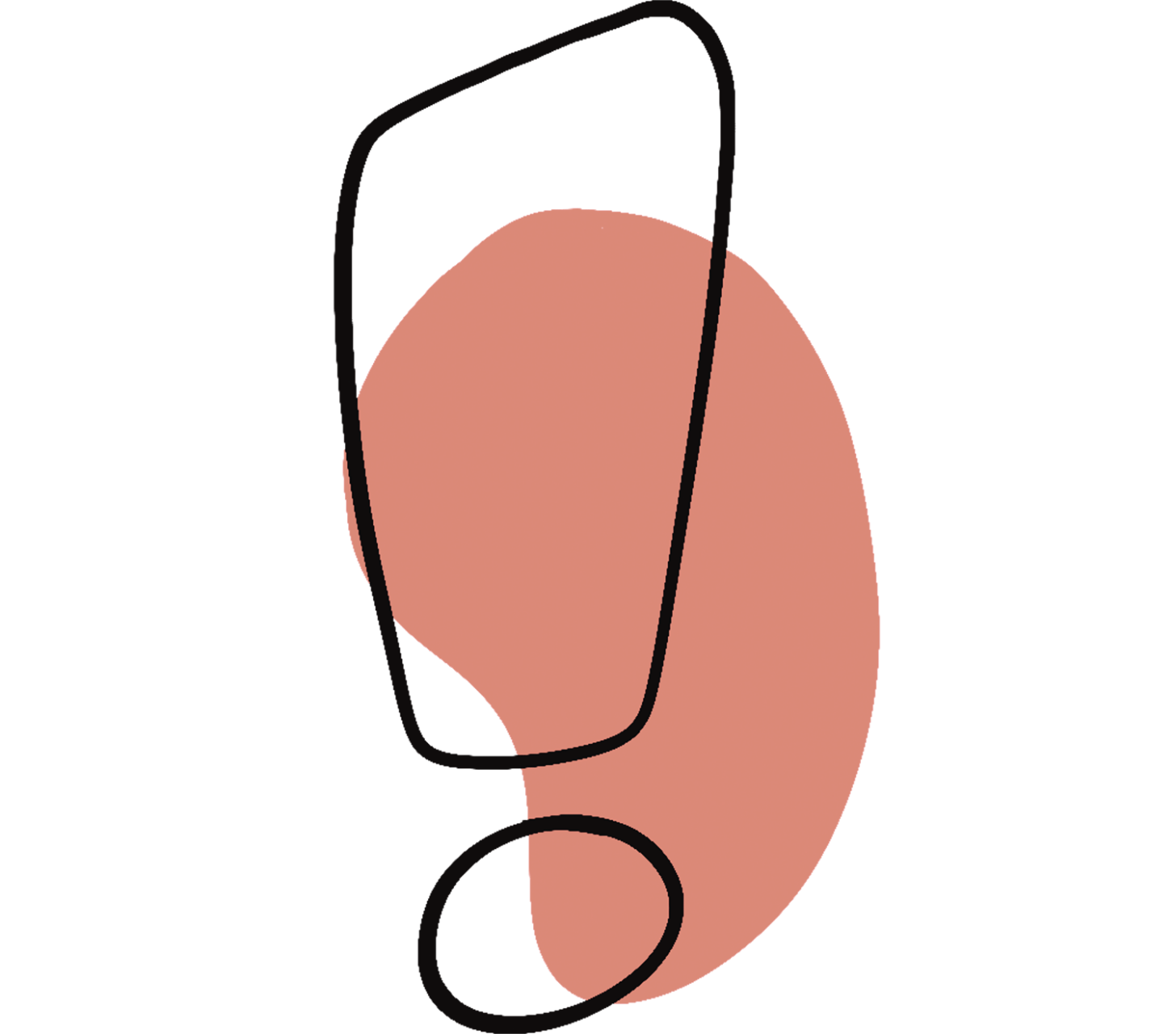
In den Naturwissenschaften wird üblicherweise sinngemäß zitiert. Das heißt, du liest den Quelltext und fasst die relevanten Aspekte in eigenen Worten zusammen.
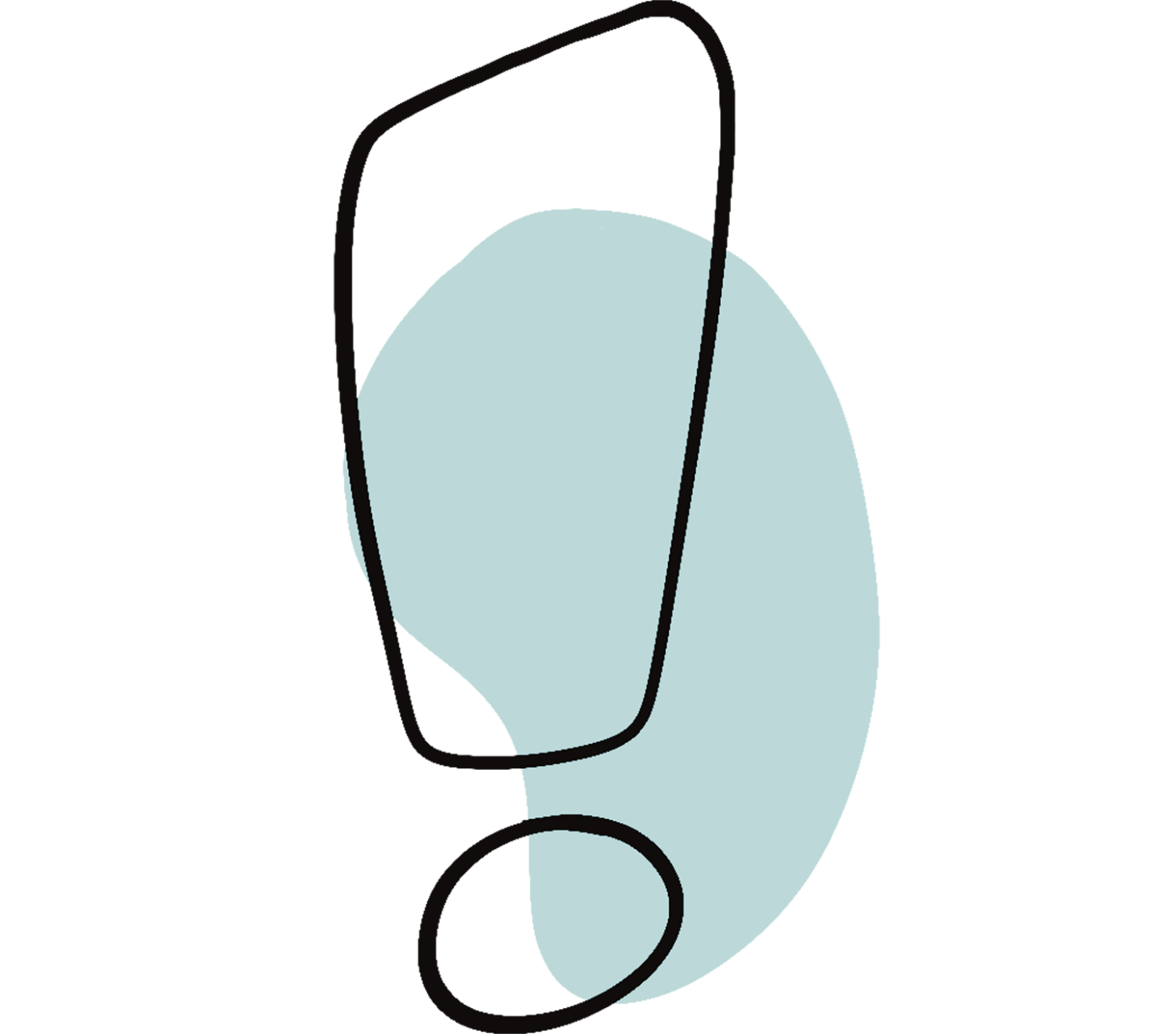
Beim Zitieren muss außerdem die genaue Seitenzahl der Literaturstelle mitangegeben werden, z. B.: [5, S. 854].
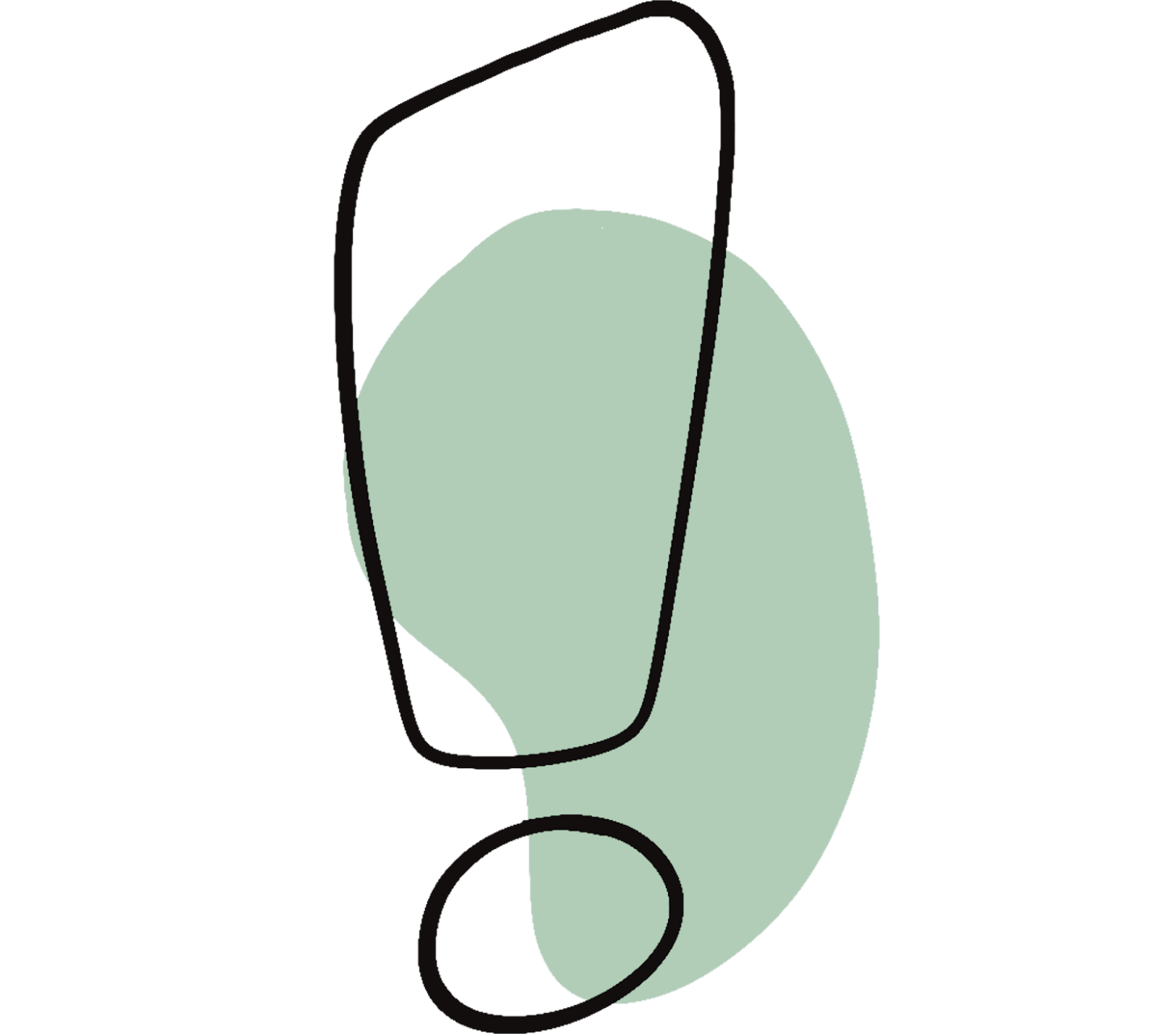
Bei mehreren Seiten gibst du den Bereich mit an, z. B.: [5, S. 852–856].
Beim direkten Zitat wird der zitierte Text in Anführungsstriche gesetzt und exakt wie in der Originalquelle angegeben:
- Wenn zur besseren Verständlichkeit Wörter eingefügt werden müssen, werden diese in eckige Klammern gesetzt.
- Wenn Teile weggelassen werden, wird dies durch […] gekennzeichnet. Dies ist nur akzeptabel, wenn dadurch der Sinn nicht verfälscht wird.

Bei Lehrbüchern oder Quellen, aus denen du verschiedene Teile zitierst, fügst du zusätzlich im Kurzhinweis noch die jeweilige Seitenzahl ein.
Im Literaturverzeichnis am Ende deiner Arbeit führst du sämtliche verwendete Literatur ausführlich auf.
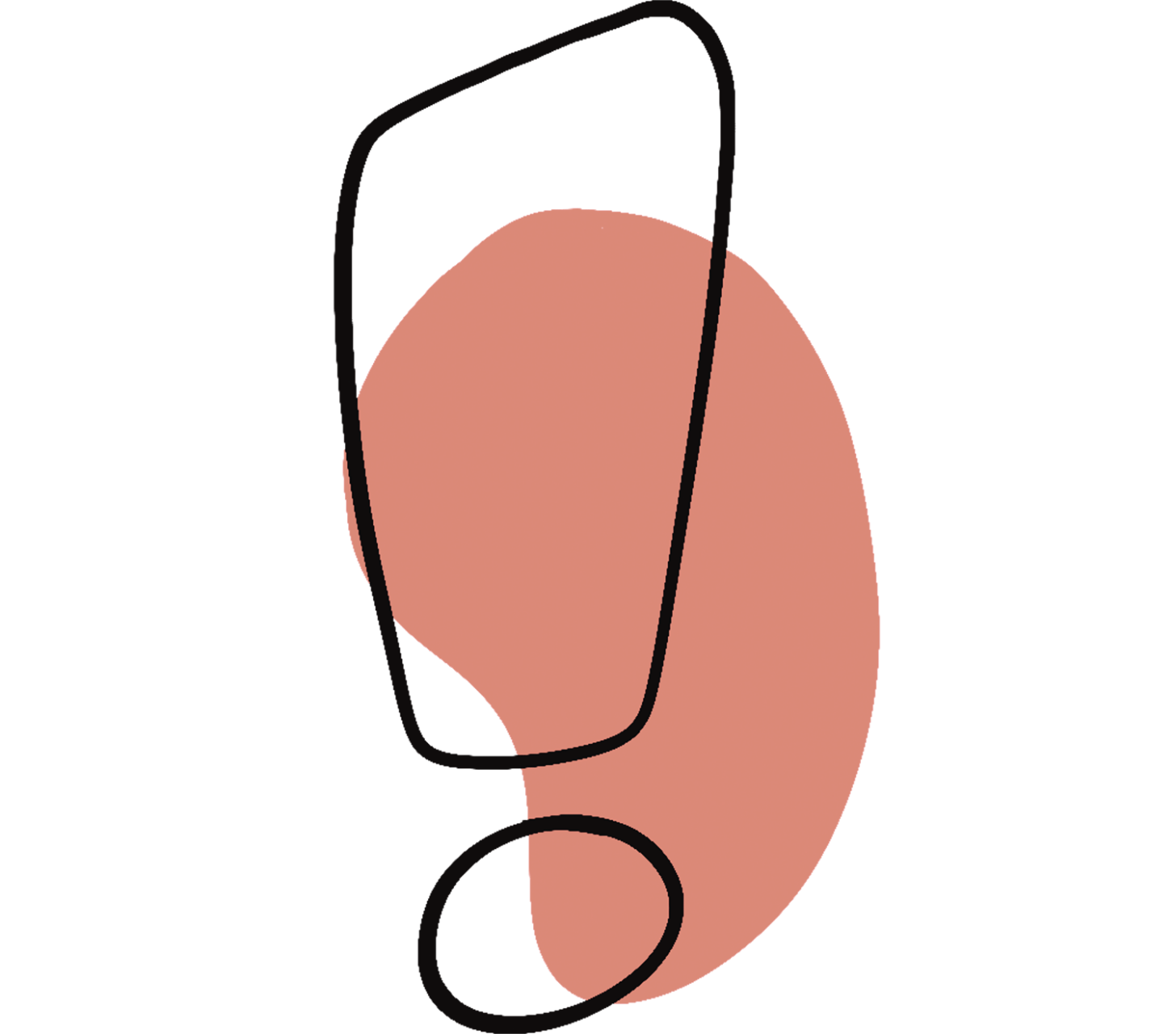
Wenn du direkte oder indirekte Zitate aus der Literatur nicht als solche kennzeichnest, gilt das als Plagiat.
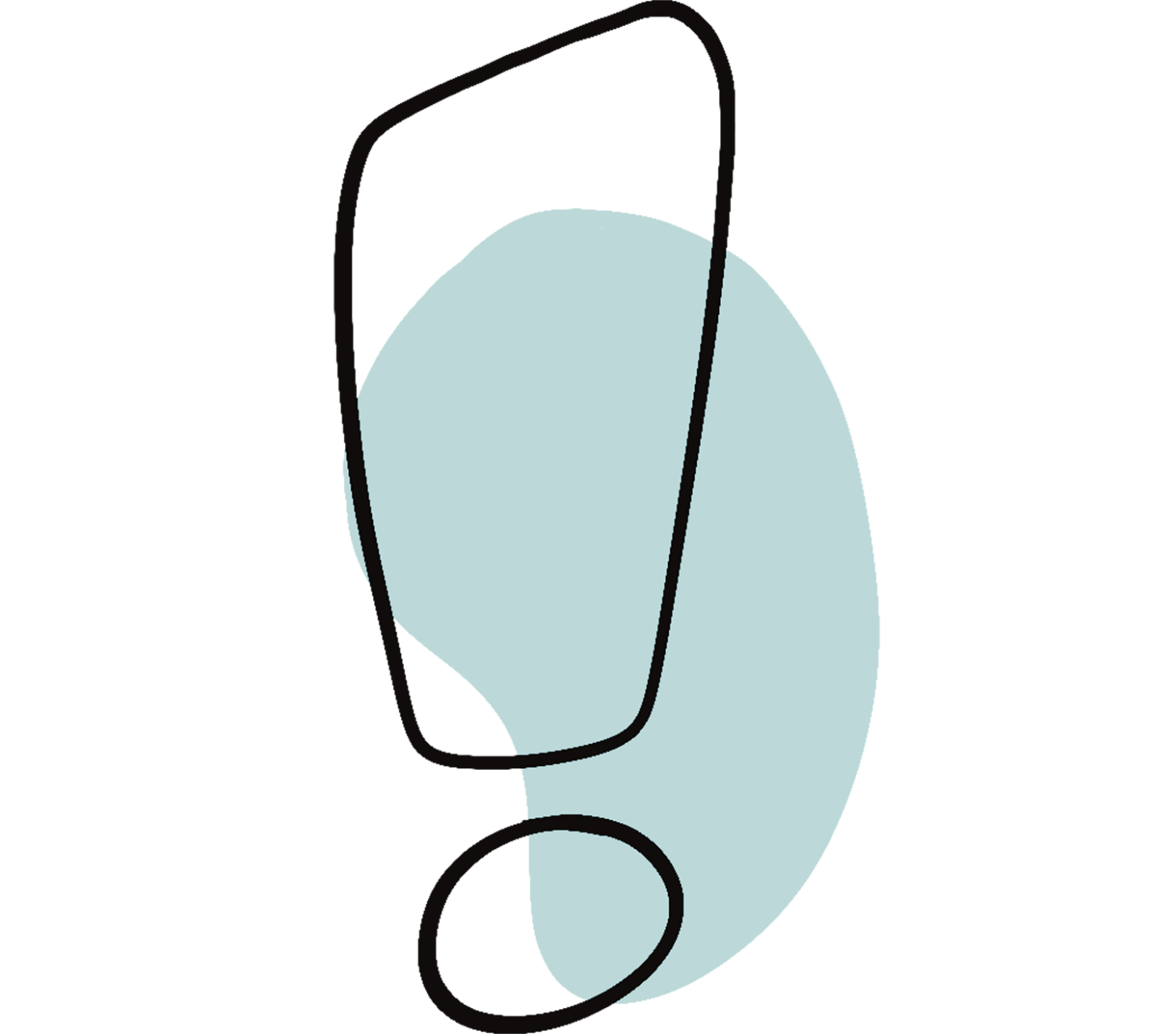
Beachte bitte die Informationen im allgemeinen Moodle-Kurs der Fakultät AC für Hinweise zum Zitierstil und einem geeigneten Programm für die Literaturverwaltung.
Literaturverzeichnis:
- Das Literaturverzeichnis ist eine vollständige Liste der verwendeten Literatur, die am Ende deiner Arbeit aufgeführt ist. Hier führst du alle Quellen auf, die du in deinem Text zitiert hast – und nur diese.
- Das Literaturverzeichnis soll es den Lesenden ermöglichen, die von dir angegebenen Quellen nachzuvollziehen. Die Angaben müssen so detailliert sein, dass die Leserschaft die Quelle eindeutig zuordnen und ggf. selbst finden und lesen kann.
- Wichtig ist, dass das Literaturverzeichnis vollständig und einheitlich ist.
- Die Literatur wird in der Reihe des Auftretens geordnet. Jeder Eintrag endet mit einem Punkt.
- Falls du einen anderen Zitierstil verwendest als den, der von der Fakultät empfohlen wird, sprich dies bitte mit deinen Betreuenden ab.
- Internetquellen werden ebenfalls zitiert: Hier immer auch das Abrufdatum angeben.
- Die Abkürzungen der chemiewissenschaftlichen Fachzeitschriften findest du auf der Website der Chemical Abstracts Service (CAS).
Literatur: U. Böhme, S. Tesch, Zitieren: Warum und wie? Nachr. Chem. 2014, 62 (9), S. 852–857.
Was passiert bei einem Plagiat?
Wenn du direkte oder indirekte Zitate aus der Literatur nicht als solche kennzeichnest, gilt das als Plagiat. Plagiate können dazu führen, dass die Arbeit als nicht bestanden gilt. Frage daher bei Unsicherheiten immer vorher deine Betreuenden.
Wie ordne ich meine Quellen in meinem Literaturverzeichnis an?
Die Literatur wird in der Reihe des Auftretens geordnet. Jeder Eintrag endet mit einem Punkt.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.