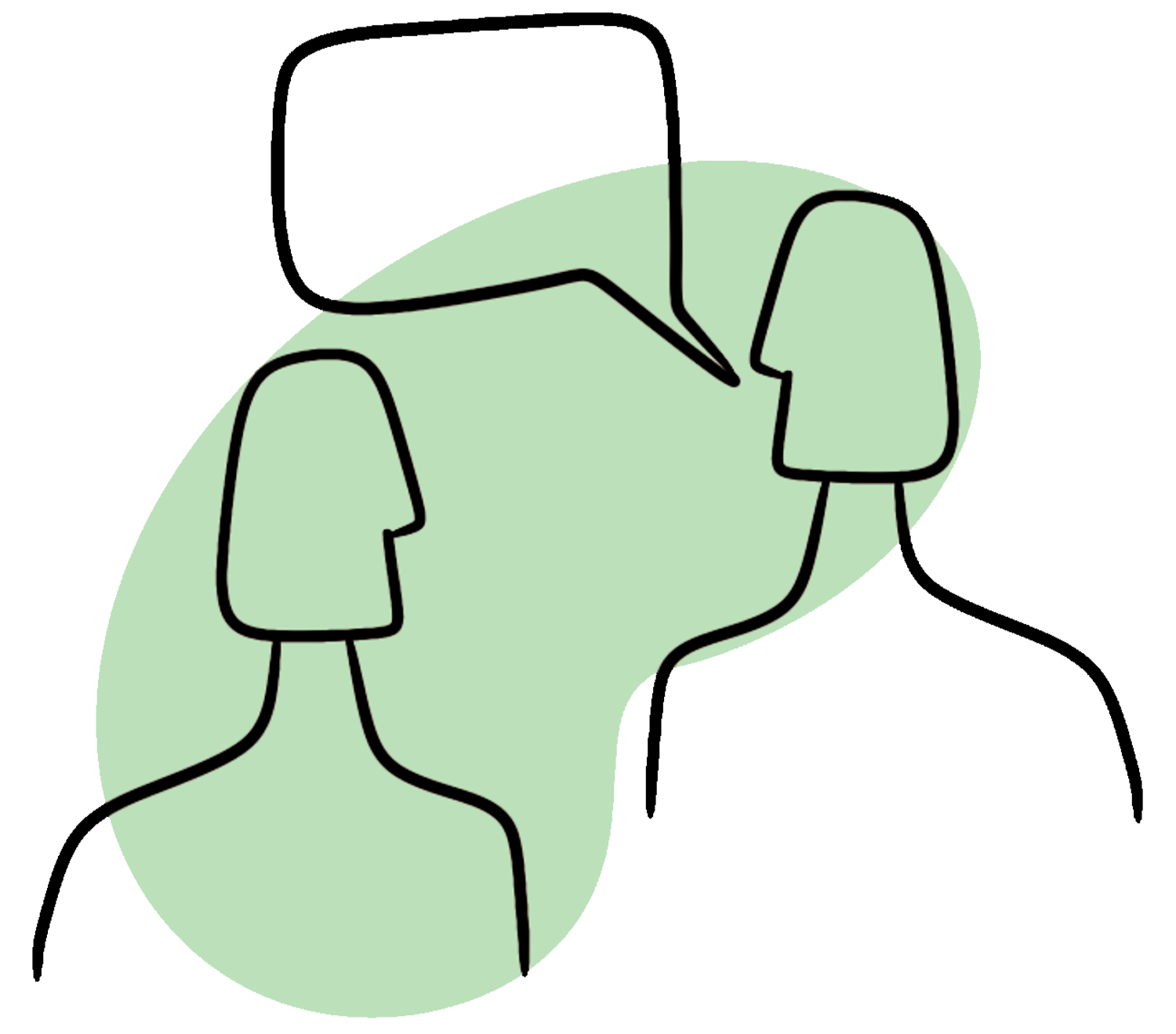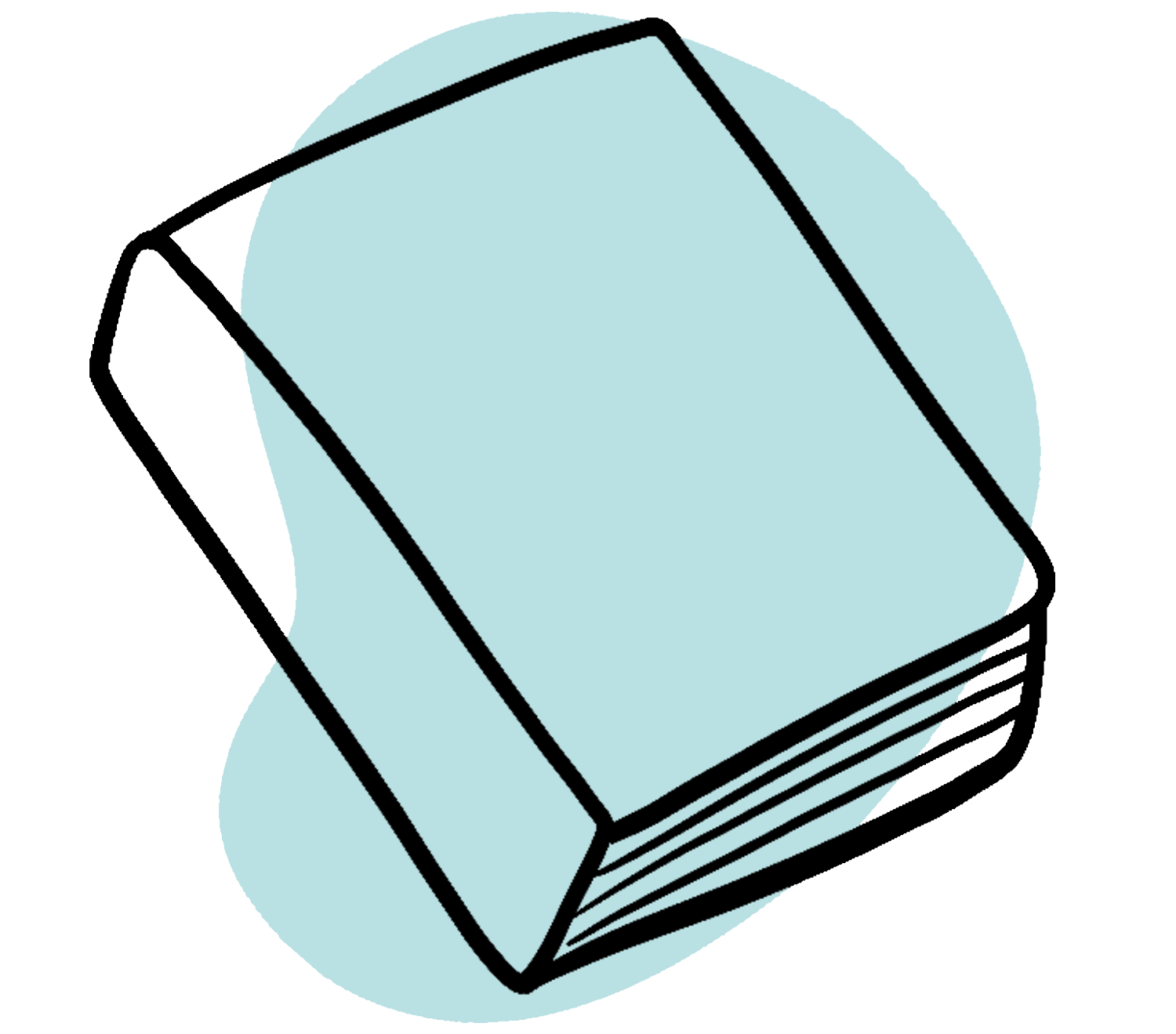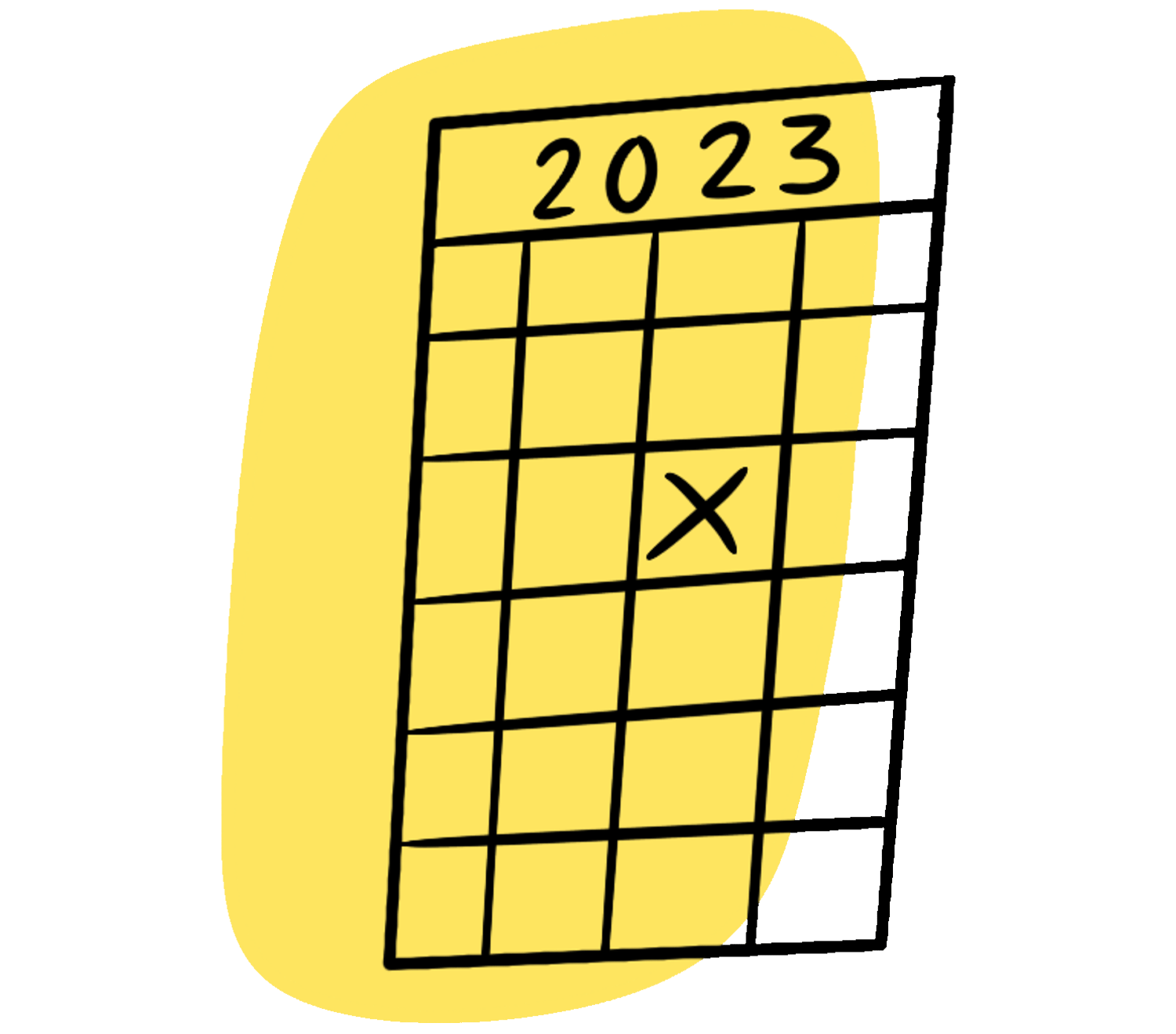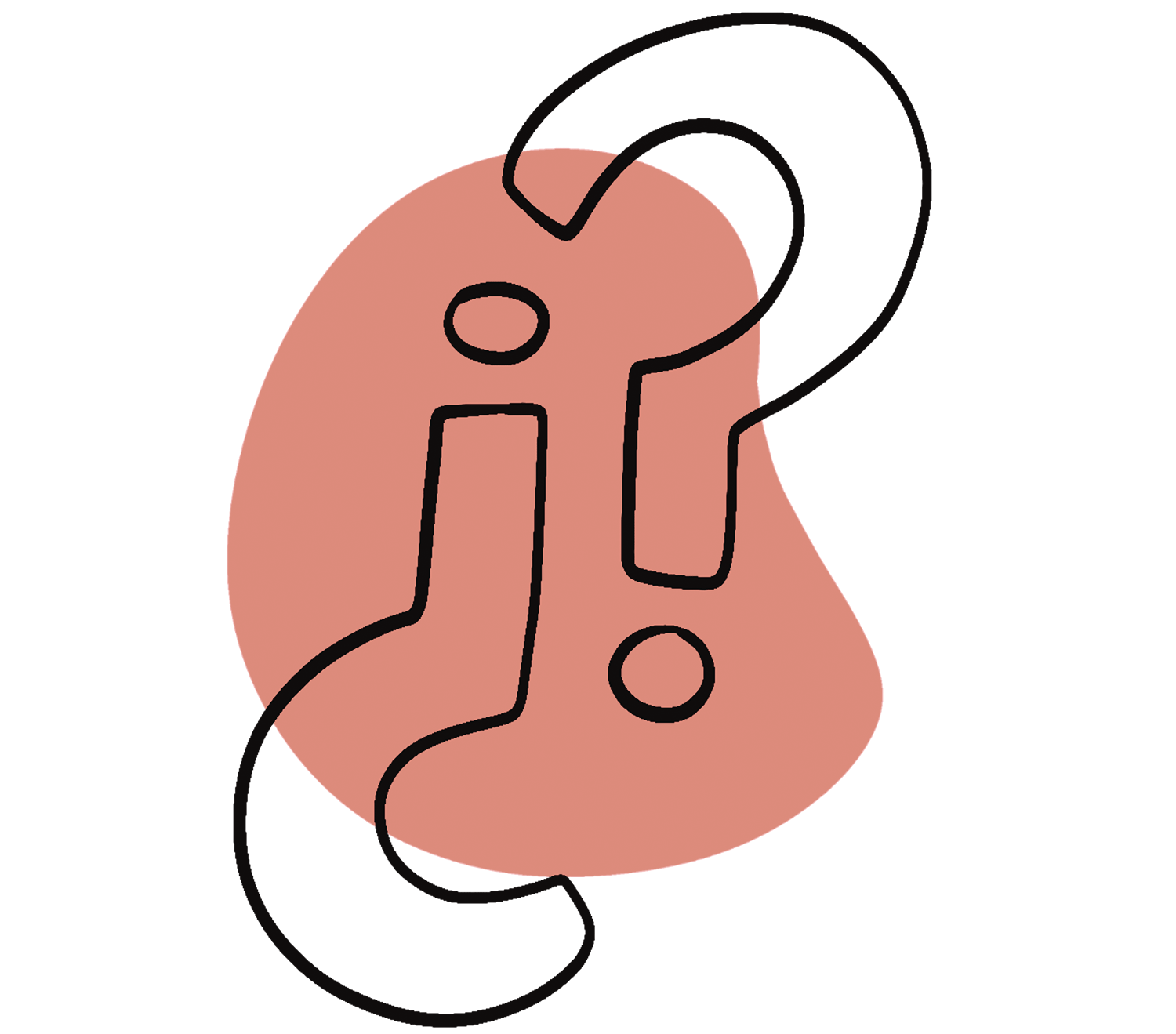Eine Möglichkeit für gendergerechte Sprache ist, sich einfach ganz neutral auszudrücken. So machen wir es aktuell auch im OWL. Hier sind einige Beispiele:
- Die Beschäftigten / die Belegschaft …
(anstatt: Arbeitnehmer) - Lehrkräfte …
(anstatt: Lehrer) - Teilgenommen haben …
(anstatt: Teilnehmer) - Der Wagen ist umgehend aus dem Halteverbot zu entfernen.
(anstatt: Der Halter des Wagens muss sein Fahrzeug aus dem Halteverbot entfernen.)
| + | Immer neutral |
| – | Eher langweilig |
Die gleichwertige Nennung femininer und maskuliner Formen ist die traditionelle Variante der sprachlichen Gleichstellung. Grammatikalische Eindeutigkeit gewährleistest du bei dieser Variante am besten, indem du Pluralformen nutzt. Im Singular können Formulierungen durch die zugehörigen Artikel bzw. Pronomen jedoch unübersichtlich werden.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …
- Den Studentinnen und Studenten …
- Den Vertreterinnen und Vertretern …
| + | Wird häufig als höflich und eindeutig gewertet |
| – | Unterstützt zwar das binäre System, aber andere Geschlechter sind nicht einbezogen |
| – | Kann im Singular zu schwer lesbaren Konstruktionen führen, z. B.: „Der Mitbewohner oder die Mitbewohnerin, der bzw. die die Kaffeemaschine nicht geputzt hat …“ |
| – | Verlängert Sätze und Texte |
Aus sprachökonomischen Gründen kannst du in Texten mit häufigen Wiederholungen stattdessen Varianten der sogenannten Sparschreibung mit Schrägstrich bzw. Klammern verwenden. Auch hier stellst du grammatikalische Eindeutigkeit durch Pluralformen her.
- Den Student(inn)en …
- Den Vertreter(inne)n …
- Den Mitarbeiter/-innen …
| + | Kurze Formulierungen |
| + | Konform mit den deutschen Rechtschreibregeln |
| – | Das Textverständnis ist zuweilen erschwert |
| – | Es sollte sich immer ein grammatikalisch korrektes und leicht lesbares Wort ergeben. Beim Verkürzen von Wortteilen deswegen Klammern und bei Wortendungen Schrägstriche verwenden: „Alle Student(inn)en und Mitarbeiter/-innen …“ |
Das Binnen-I ist eine Schreibweise, die die Geschlechter weiblich und männlich gleichstellt, wie in diesen Beispielen:
- Die MitarbeiterInnen …
- Den StudentInnen …
- Den VertreterInnen …
| – | Unterstützt die binäre Logik |
| – | Nicht konform mit den deutschen Rechtschreibregeln |
Diese Formen des Genderns sind mittlerweile wohl diejenigen, die am häufigsten genutzt werden. Hier ein paar Beispiele:
- Die Mitarbeiter_innen …
- Die Wissenschaftler:innen …
- Den Vertreter*innen …
- Liebe*r Vorname Nachname …
- Frauen* …
| + | Vermeidet binäre Schreibweisen |
| + | Doppelpunkt in Braille von Blinden lesbar, Sternchen und Unterstrich oft nicht unterstützt |
| + | Symbolisiert Raum für Personen, die sich in einem zweigeschlechtlichen System nicht wiederfinden |
| + | Das Gender-Sternchen wird seit 2020 im Rechtschreibduden als „vom amtlichen Regelwerk nicht abgedeckte“ Möglichkeit des gendersensiblen Sprachgebrauchs aufgeführt – es ist also quasi in Ordnung, wenn auch nicht hochoffiziell in Ordnung |
Darf und sollte ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit trotz dem Genderverbot in Bayern noch gendersensibel schreiben?
Forschende und Studierende dürfen weiterhin gendern, denn es gilt die Forschungsfreiheit. Die Verwendung von gendersensibler Sprache ist eine Frage deiner persönlichen Haltung, aber auch abhängig vom Fach und der Zielgruppe. Im Studium und in der Praxis der Sozialen Arbeit ist es z. B. mittlerweile üblich, auf eine gendersensible Schreibweise zu achten. Folge den hier vorgestellten Regeln, um das generische Maskulinum zu vermeiden.
Was versteht man unter Gender?
Gender kommt aus dem Englischen und steht im deutschsprachigen Raum mittlerweile als Fachbegriff für das soziale Geschlecht. Darunter versteht man die eigene Wahrnehmung und die eigene Zugehörigkeit zu einem oder auch zu mehreren Geschlechtern. Es ist nicht zu verwechseln mit dem biologischen Geschlecht.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.