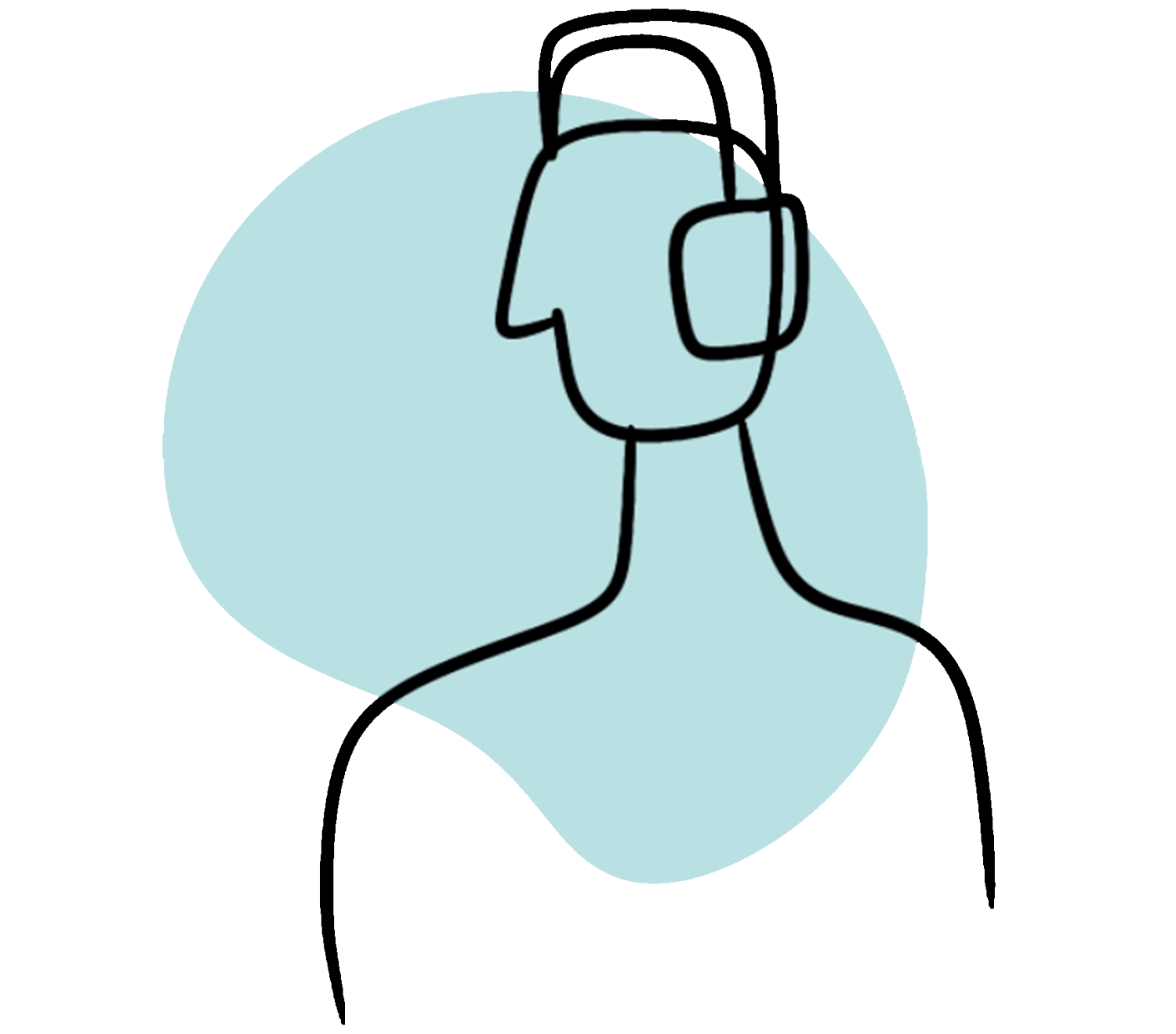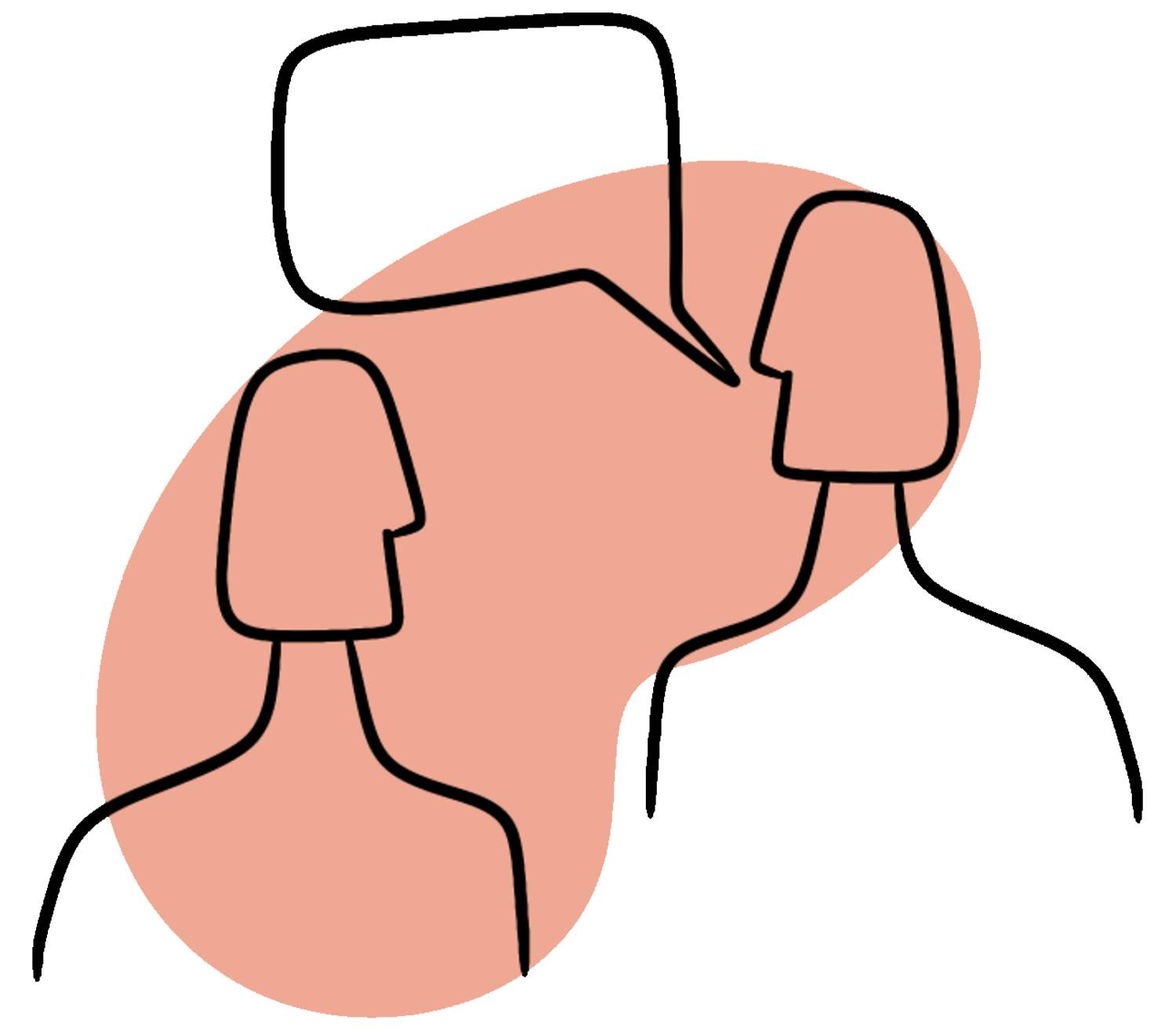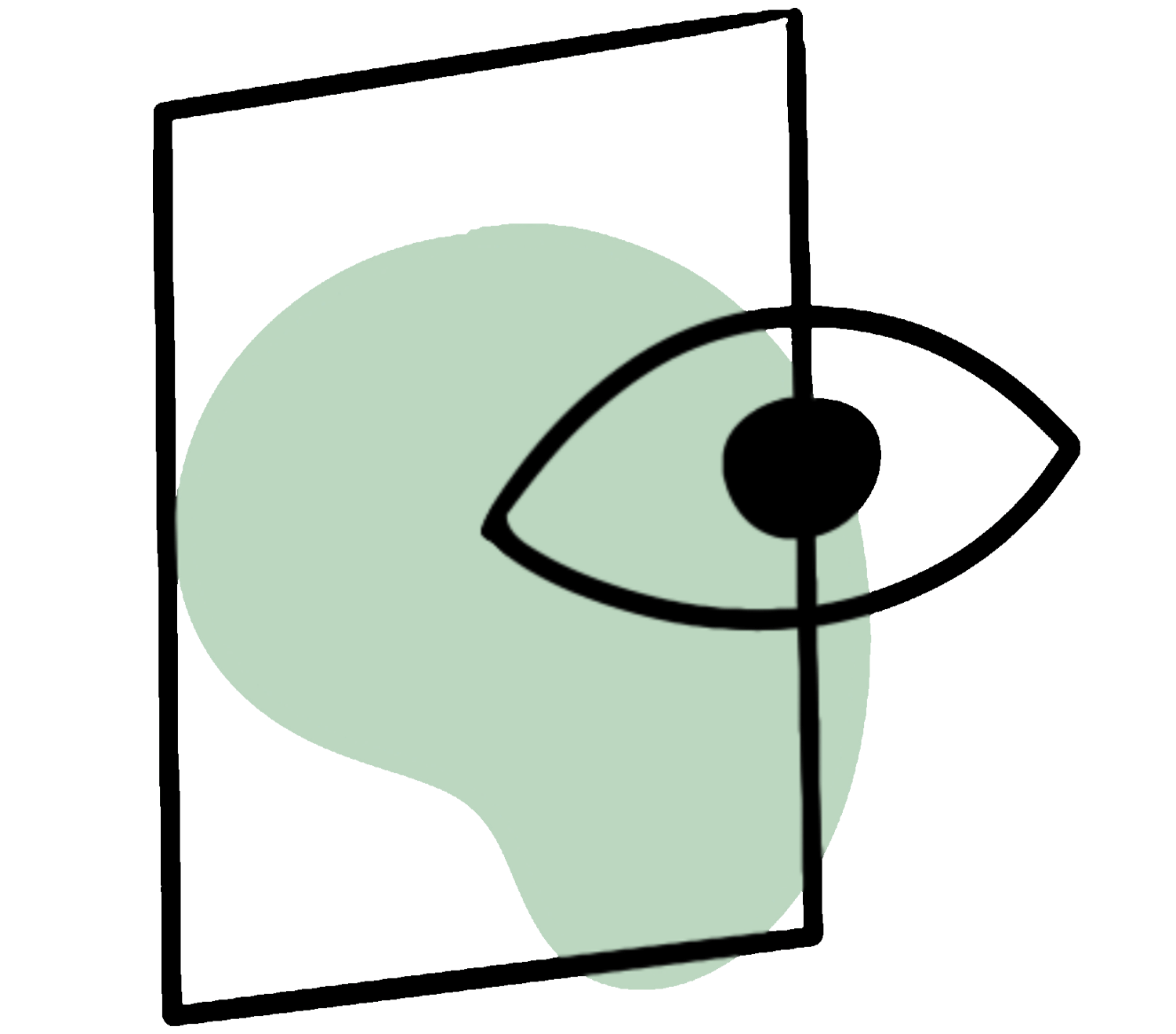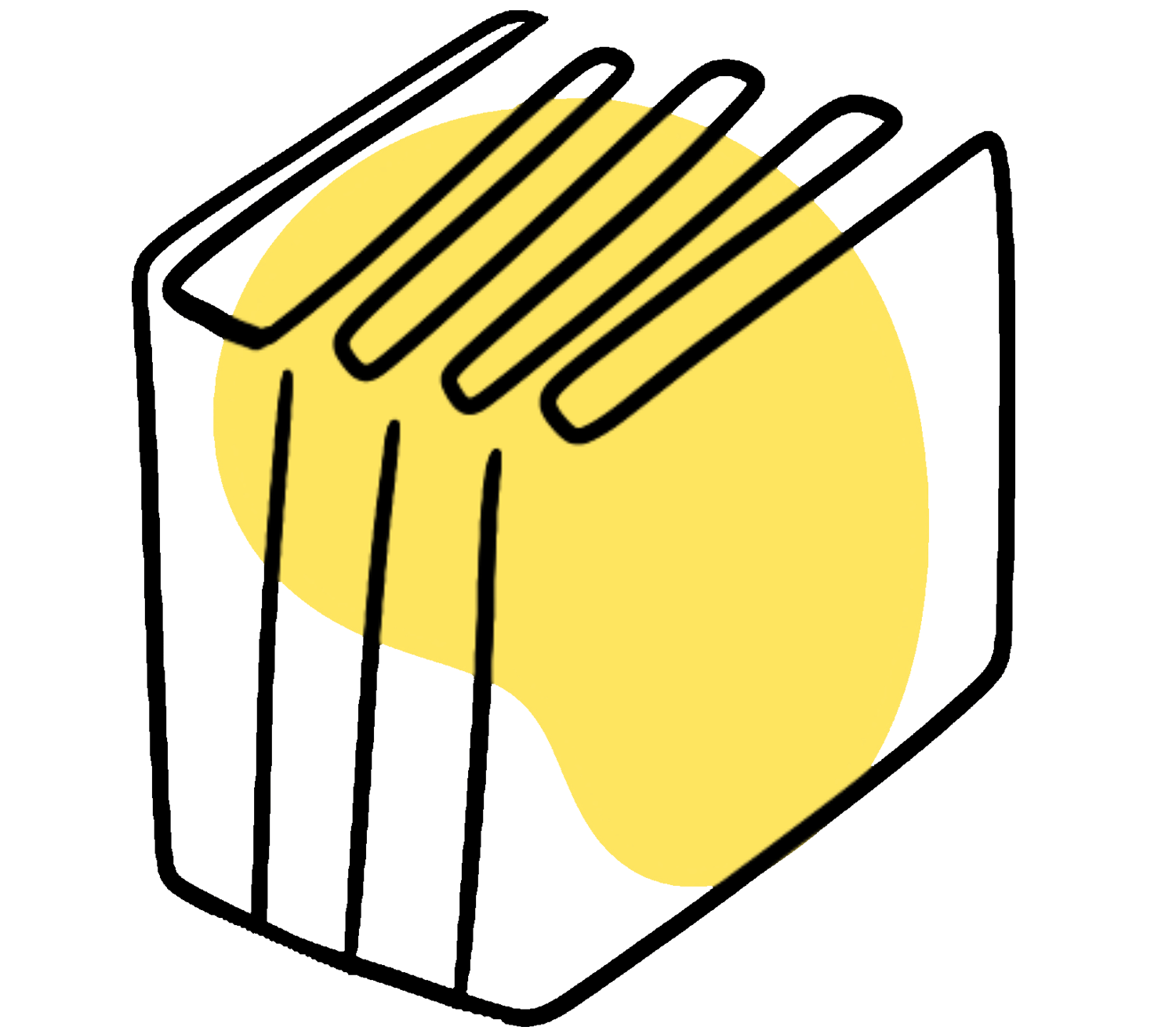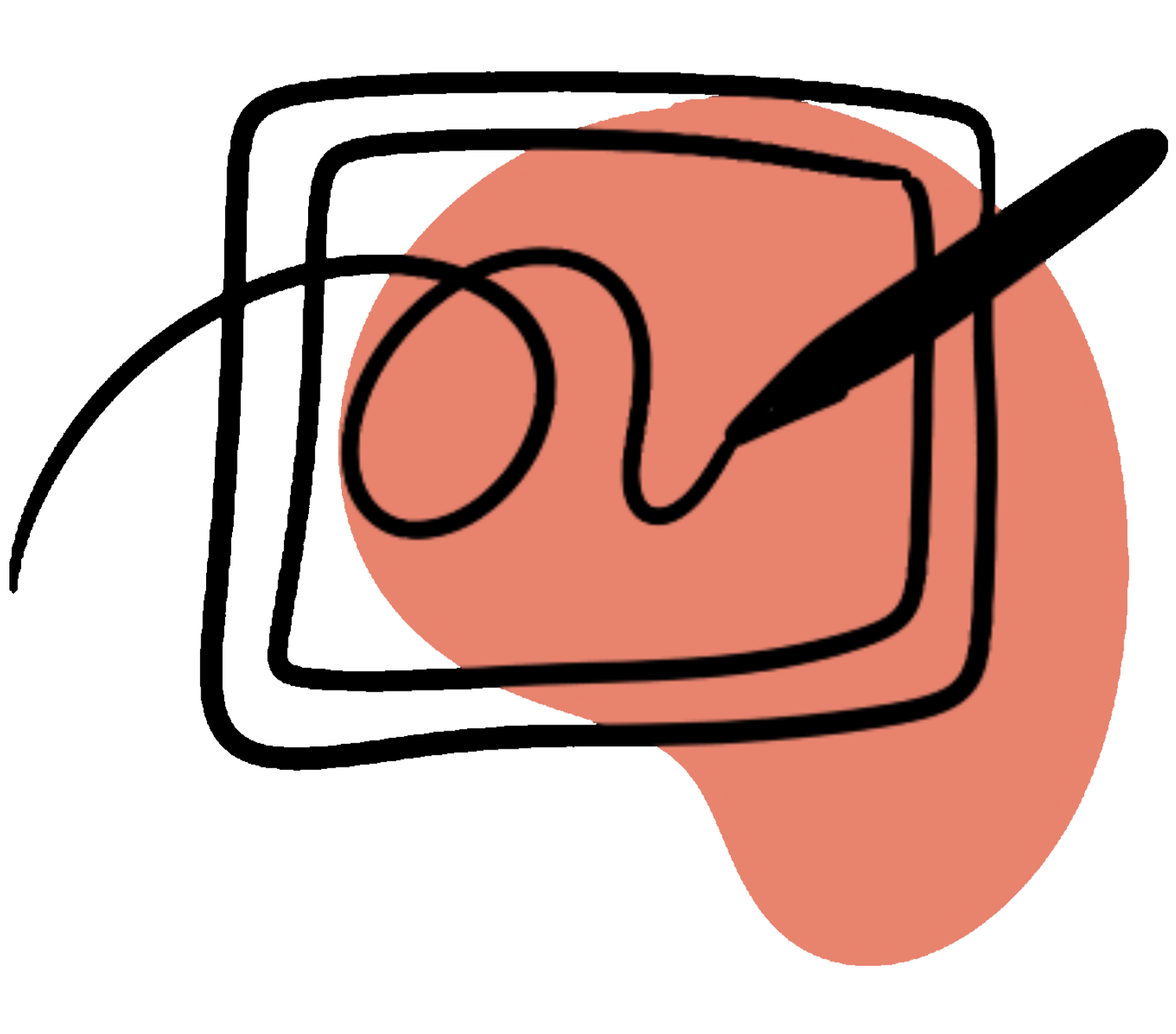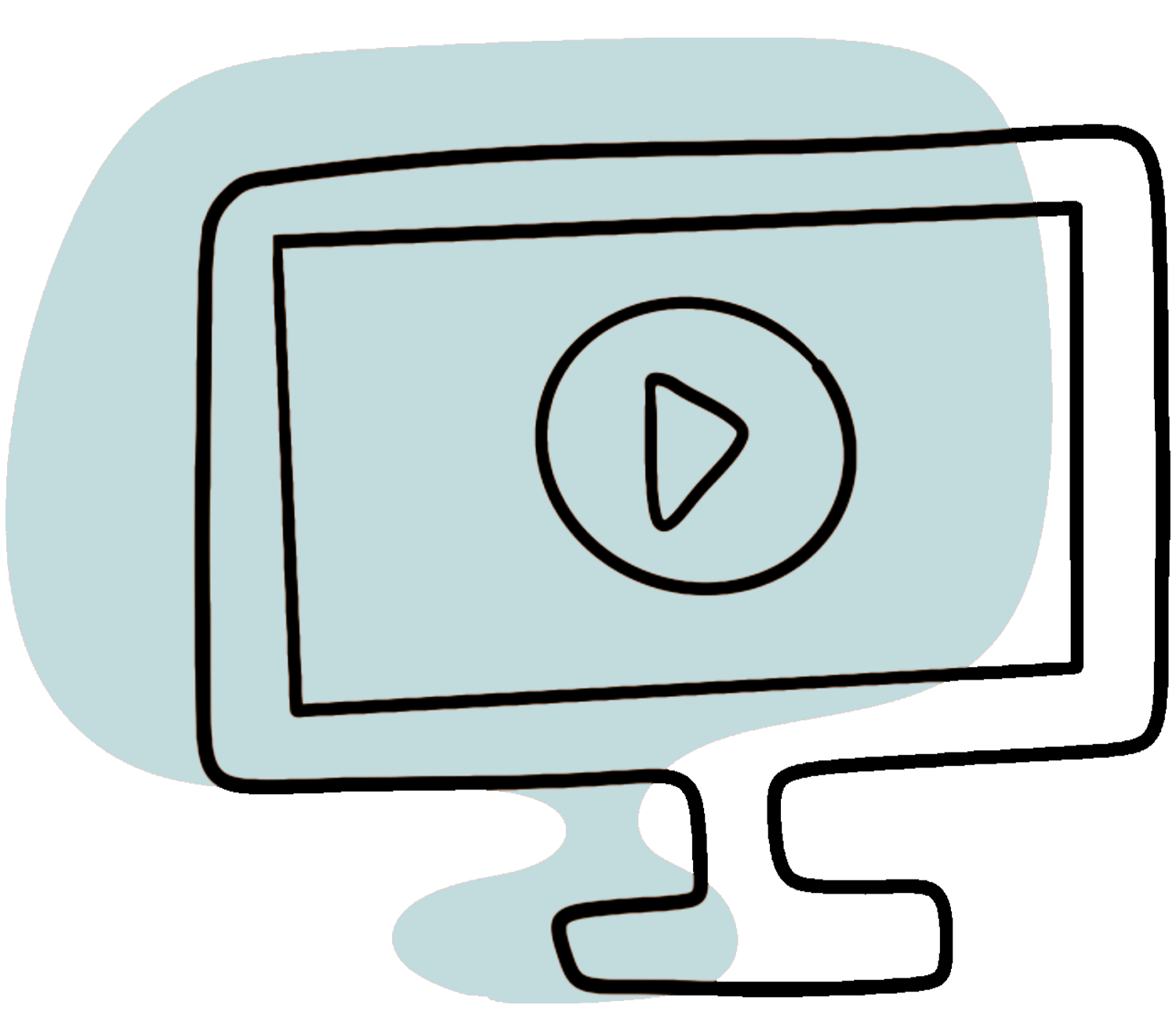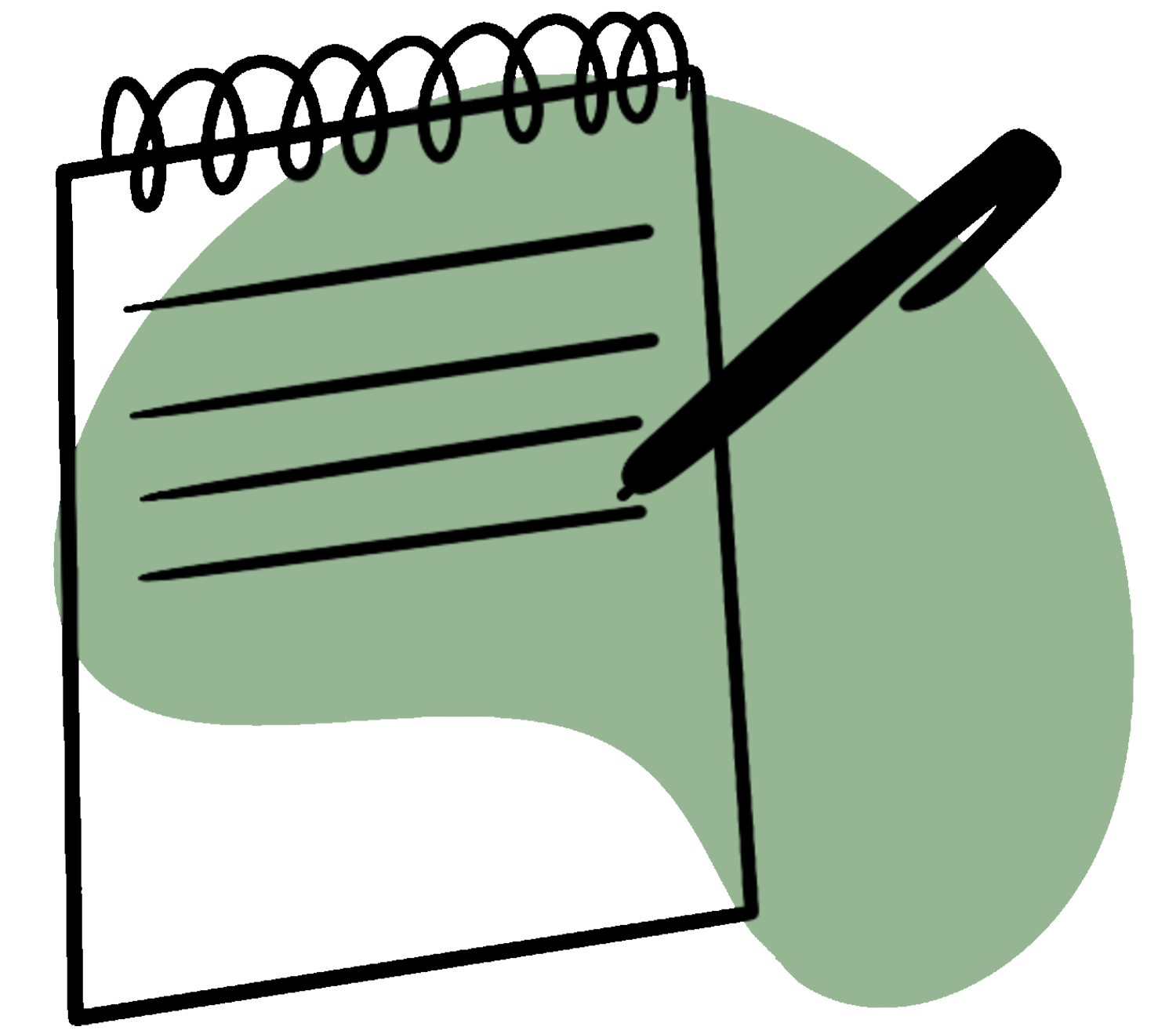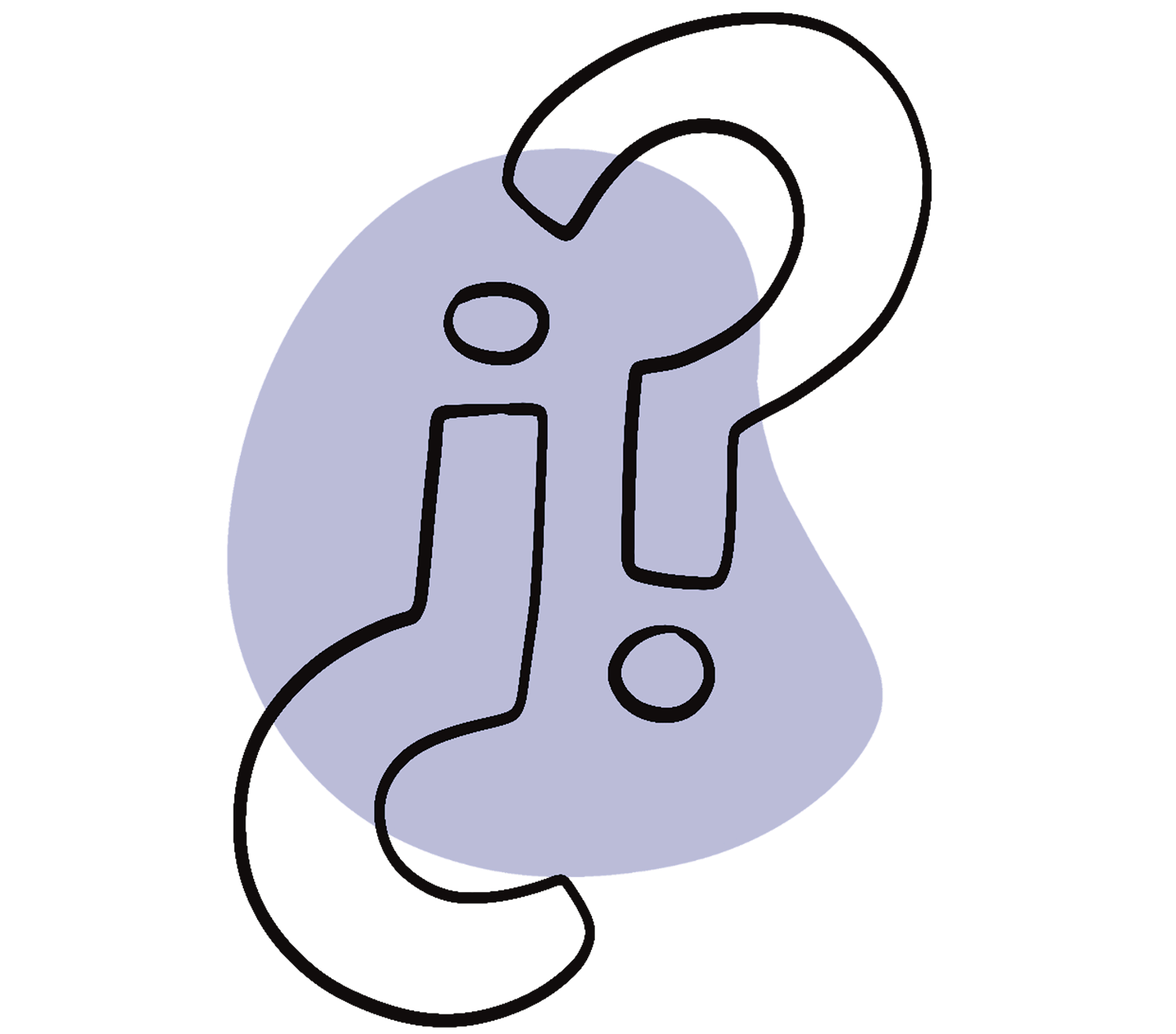Eine wichtige Ressource während deines Schreibprozesses sind deine Mitstudierenden. Studierende aus höheren Semestern haben vielleicht schon hilfreiche Erfahrungen gemacht, die sie mit dir teilen können. Studierende im gleichen Semester haben evtl. besondere Kenntnisse, die deine eigenen sinnvoll ergänzen. Über das eigene Thema zu sprechen, hilft dabei, Probleme zu lösen, Gedanken zu schärfen und treffende Formulierungen zu finden. Ihr könnt euch gegenseitig hilfreiche Tipps geben. Besonders wertvoll ist es, sich wechselseitig Text-Feedback zu geben.
Gutes Text-Feedback ist:
- konkret – bezieht sich auf einzelne Textstellen
- begründet – erläutert, warum etwas gelungen oder misslungen ist
- priorisiert – bewertet die Einzelkritik im Hinblick auf den Gesamteindruck
- wertschätzend formuliert – und wenn nicht, trage es mit Fassung, und mache es selbst besser.
Schreibtandems oder Schreibgruppen können dir helfen, produktiver zu arbeiten, Motivationslöcher zu überwinden und Knoten im Kopf zu beseitigen. Mitglieder von Schreibgruppen unterstützen sich gegenseitig, indem sie einander Text-Feedback geben, gemeinsam schreiben, zusammen Probleme lösen, über Schreibfortschritte und Herausforderungen berichten, sich Ziele setzen und sich sanft daran erinnern, diese auch einzuhalten.

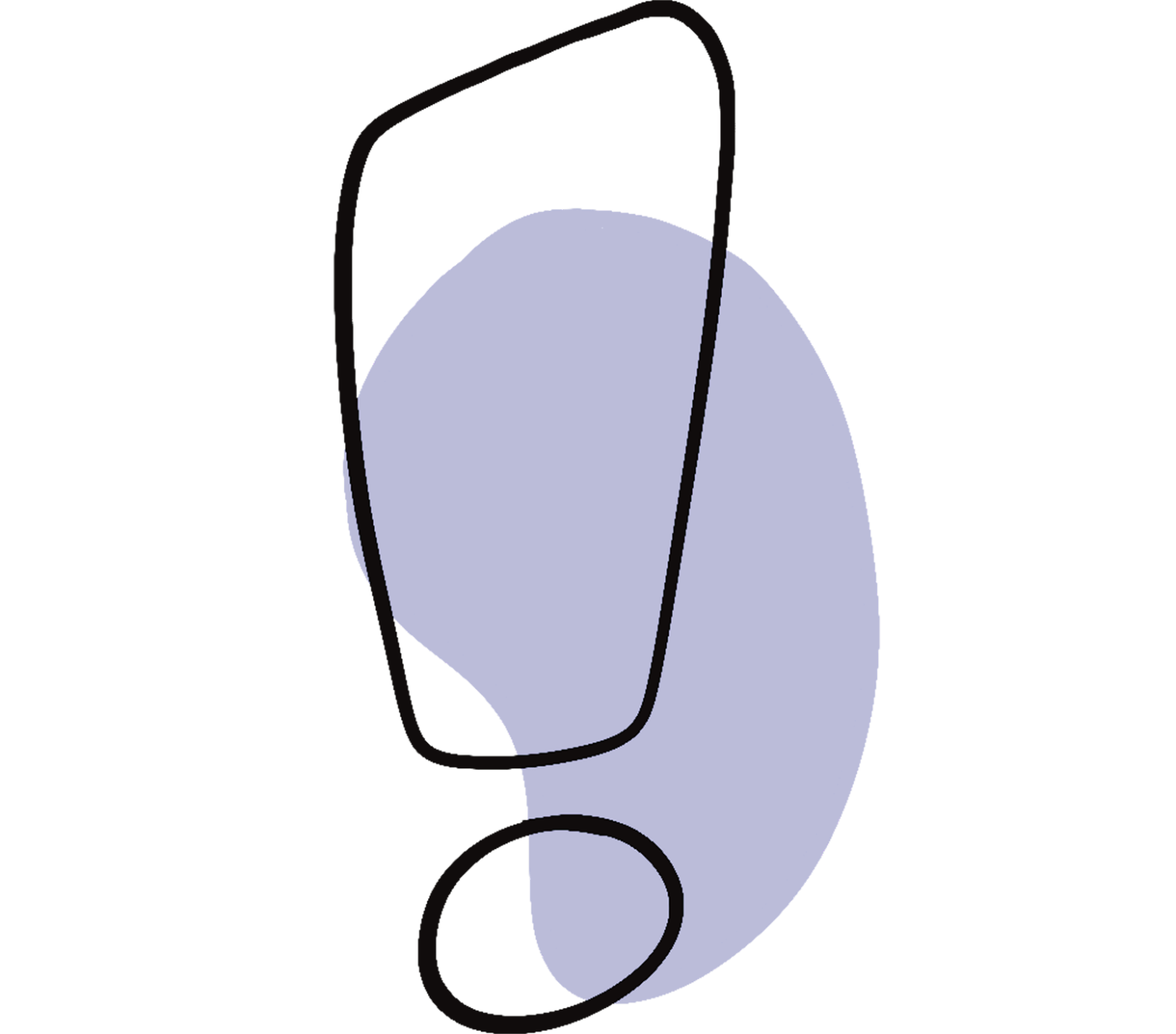
Das Schreibzentrum unterstützt die Bildung von Schreibgruppen immer wieder durch die Organisation von Auftakttreffen, und bietet auch eine offene Schreibgruppe an.
Lehrende bieten unterschiedliche Arten von Unterstützung beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit. Finde heraus, wie diese aussieht, und nutze das Angebot. Beachte die Merkblätter, den Seminarplan und ggf. die Moodle-Kursräume der Lehrenden. Frage nach den Anforderungen an die jeweilige wissenschaftliche Arbeit. Manchmal scheuen sich Studierende, angebotenes Feedback anzunehmen – nutze diese Chance: Gehe zur Einsichtnahme, lies die Kommentare durch, frag nach.
Die Bibliothek unterstützt dich bei Fragen rund um die Literaturrecherche und Literaturverwaltung. Dazu gehören auch Abschlussarbeitsberatungen und Einführungen in Literaturverwaltungsprogramme, wie Citavi oder Zotero. Insbesondere zu Semesterbeginn führt die Bibliothek Einführungsveranstaltungen durch, in denen du die Grundlagen zu Literatursuche und Ausleihe erfährst. Es gibt auch eine Wahlfachvorlesung zur wissenschaftlichen Literaturrecherche. Kontaktiere die Bibliothek bei Fragen zu Datenbanken, Fachzeitschriften oder Fernleihe. Scheue dich nicht, das Personal der Bibliothek um Rat und Hilfe zu bitten.
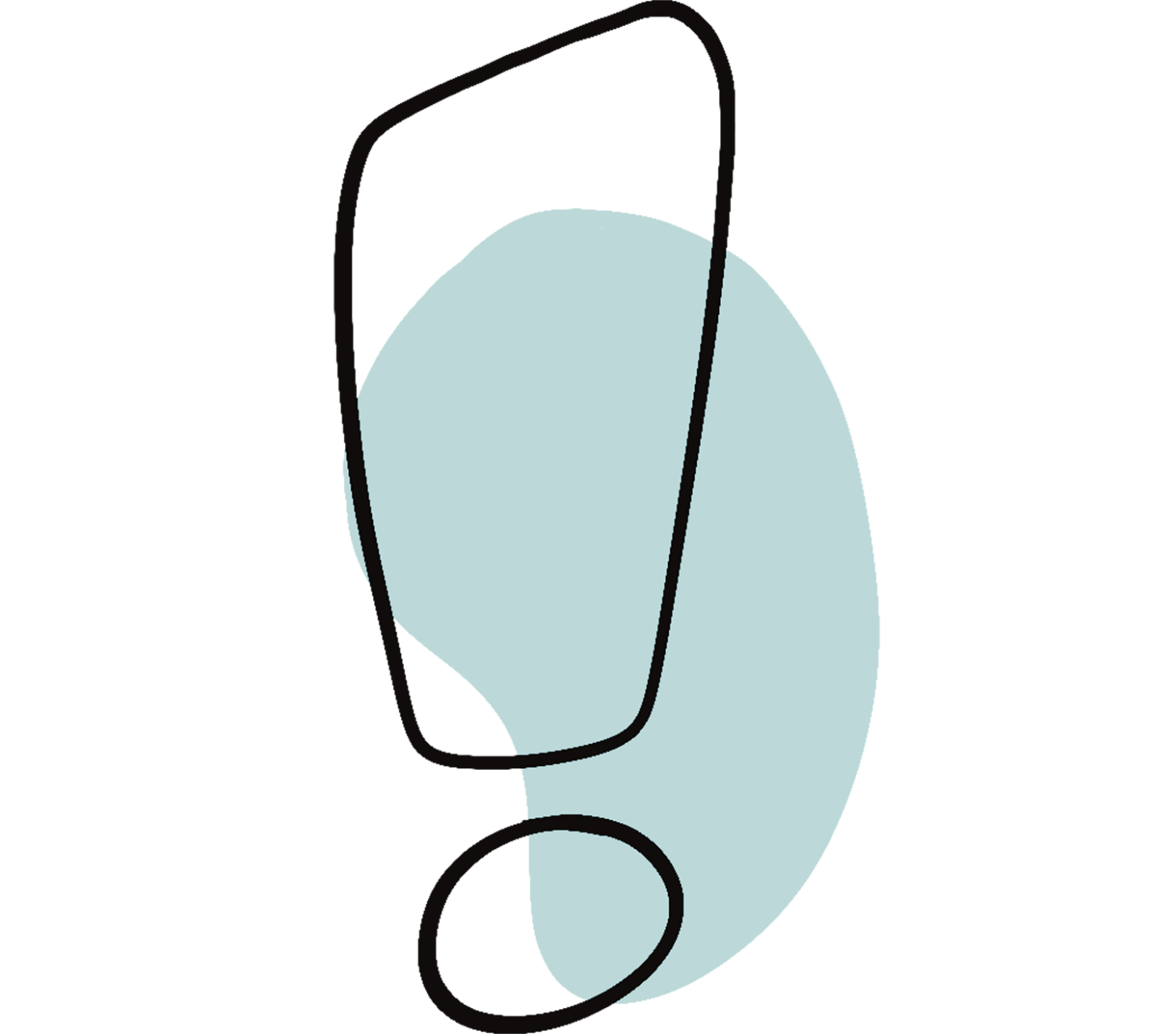
Das Schreibzentrum bietet Workshops an, die Grundlagen vermitteln und den Austausch ermöglichen. In der Schreibberatung beraten dich Schreibtutorinnen und -tutoren individuell zu deinem Text und deinem Schreibprozess. Du kannst deinen Text auch hochladen und schriftliches Text-Feedback auf einige Seiten erhalten. Und: Gehe zum Schreibtag, an dem du einmal im Semester Workshops besuchen, und gemeinsam mit anderen einen Tag lang durchschreiben kannst.
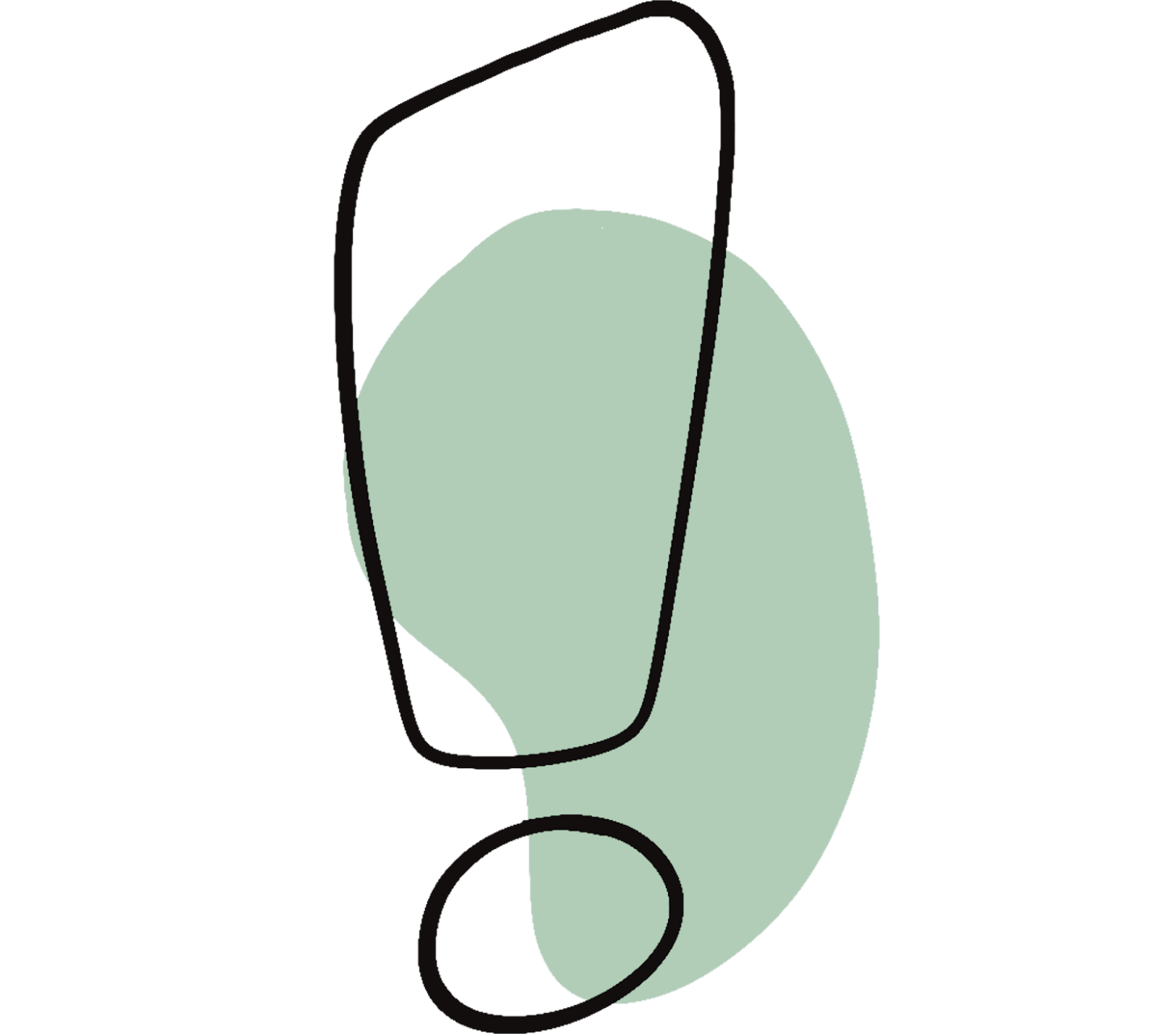
Das OWL kann nicht alle Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben beantworten. Im Internet und auf Social Media findest du verschiedene Angebote, die sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben beschäftigen. Lass dich nicht davon beirren, dass es viele unterschiedliche Konventionen gibt.

Beim wissenschaftlichen Schreiben brauchst du verschiedene Programme, z. B. für die Textverarbeitung, die Erstellung von Grafiken, die Recherche von Fachliteratur, oder die Zusammenarbeit mit anderen. Es spart viel Zeit und Nerven, die verwendete Software gut zu beherrschen. Beschäftige dich am besten schon frühzeitig mit der Software, die du für die Abschlussarbeit verwenden willst.
Unterstützung gibt es hier:
- Die Zentrale IT der TH Nürnberg stellt im Intranet Software zur Verfügung, und bietet Anleitungen zur Installation und Nutzung an.
- Die Bibliothek bietet Schulungen und eine Sprechstunde für die Literaturmanagementsoftware Zotero an.
- Das RRZE (Rechenzentrum Erlangen) der FAU führt Softwareschulungen durch, z. B. für LATEX oder Word – auch für Studierende der TH Nürnberg.
Schreiben ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn du nicht in der eigenen Muttersprache schreibst. Hier einige Hinweise für Nicht-Muttersprachler/-innen, die an der Hochschule auf Deutsch schreiben:
- Nutze ein deutschsprachiges Textverarbeitungsprogramm.
- Verwende die Rechtschreib- und Grammatikkorrektur deiner Textverarbeitung.
- Übernehme keinesfalls vollständige Sätze wörtlich aus der Literatur, ohne sie als Zitat zu kennzeichnen. Das fällt auf. Versuche, die Literatur in eigenen Worten wiederzugeben, auch wenn das am Anfang schwer fällt. Die Quelle musst du auch angeben, wenn du den Gedanken in eigenen Worten formulierst.
- Lass den Text vor der Abgabe von deutschsprachigen Mitstudierenden oder Freundinnen und Freunden Korrektur lesen.
- Hänge dich bei deinem Rohtext nicht an Rechtschreibung und Formulierung auf, sondern konzentriere dich zunächst auf den Inhalt. Vor der Abgabe muss die Sprache aber natürlich nochmal geprüft und korrigiert werden.
- Formuliere einfach und verständlich. Verstecke den Inhalt nicht in unnötig komplizierten Formulierungen. Wissenschaftliche Texte sind Arbeitsdokumente und sollten beim ersten Lesen verständlich sein.
- Falls du dich auf Englisch besser ausdrücken kannst als auf Deutsch, frag deine Prüfenden, ob du die Arbeit auch auf Englisch schreiben darfst.
Was gehört zum Schreibprozess?
Im Schreibprozess werden vier zentrale Arbeitsschritte voneinander unterschieden: Planen, Strukturieren, Formulieren, Überarbeiten. Tatsächlich gibt es aber viel mehr Aufgaben, die zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit dazugehören: Fragestellung formulieren, mit Lehrenden besprechen, Lesen, Recherchieren, Korrigieren etc. Diese Schritte werden auch meist nicht der Reihe nach durchlaufen. Stattdessen wirst du einzelne Aufgaben immer wieder ausführen, wie z. B. Lesen oder Feedback einholen.
Wie kann ich besser schreiben?
Schreiben kann man lernen. Je öfter du schreibst, desto besser wirst du. Außerdem ist es wichtig, über das Ziel und die Zielgruppe deines Textes nachzudenken, Feedback einzuholen und den Text häufig zu überarbeiten.
Der Artikel wurde veröffentlicht im Juni 2025 und zuletzt aktualisiert im Juni 2025.