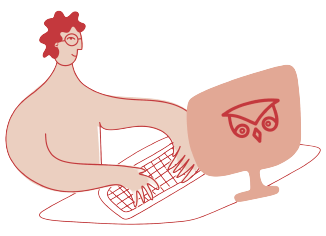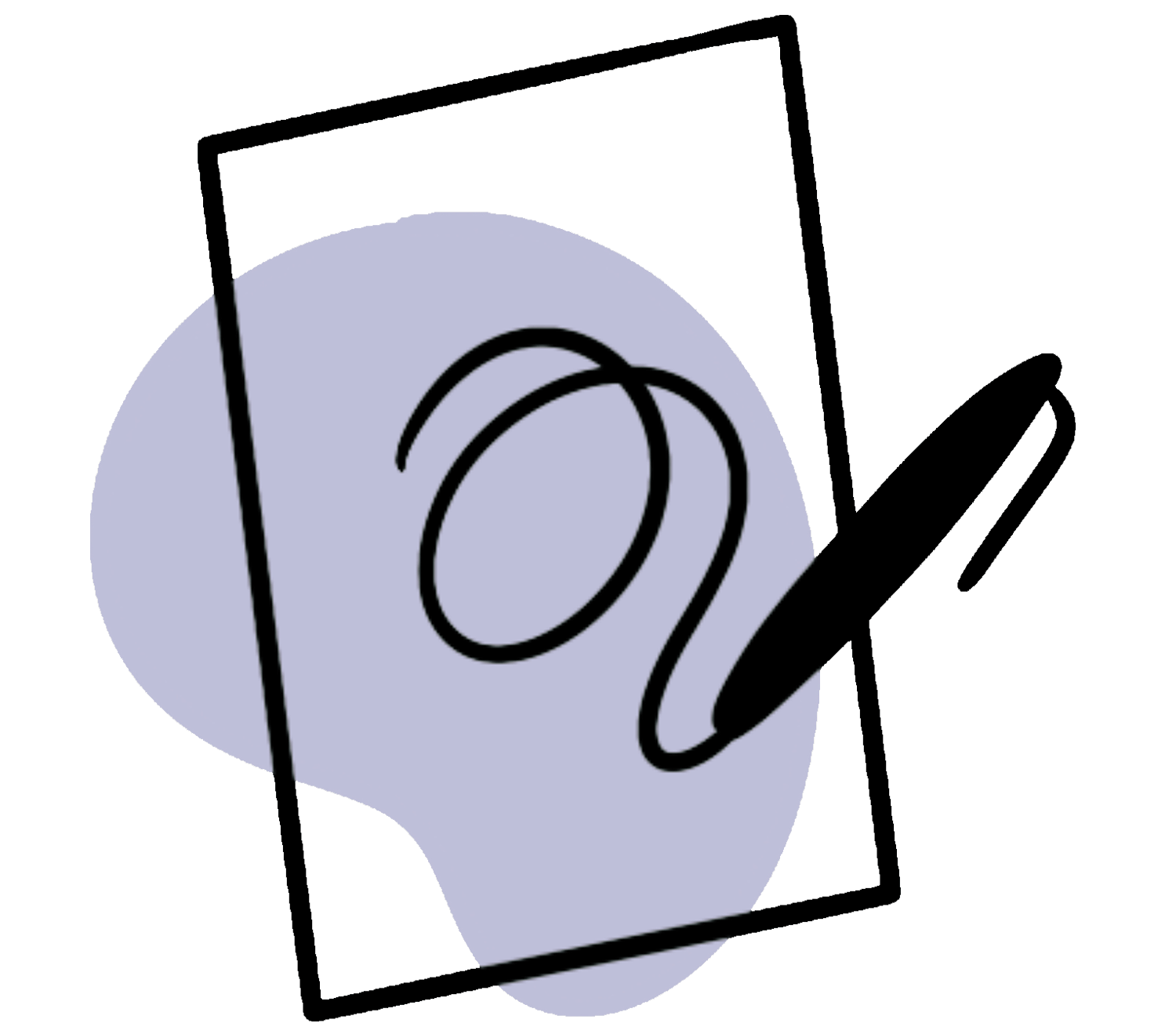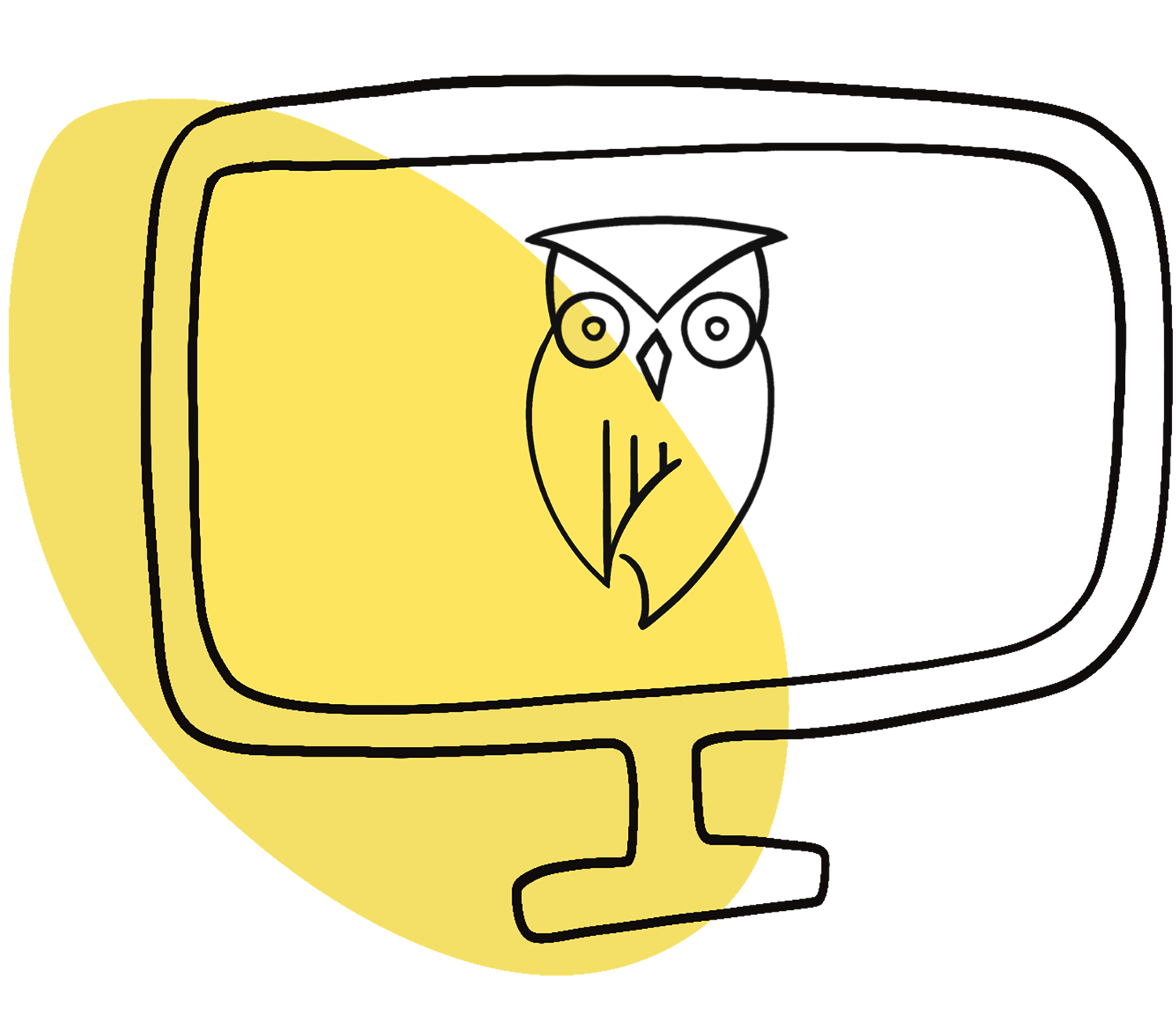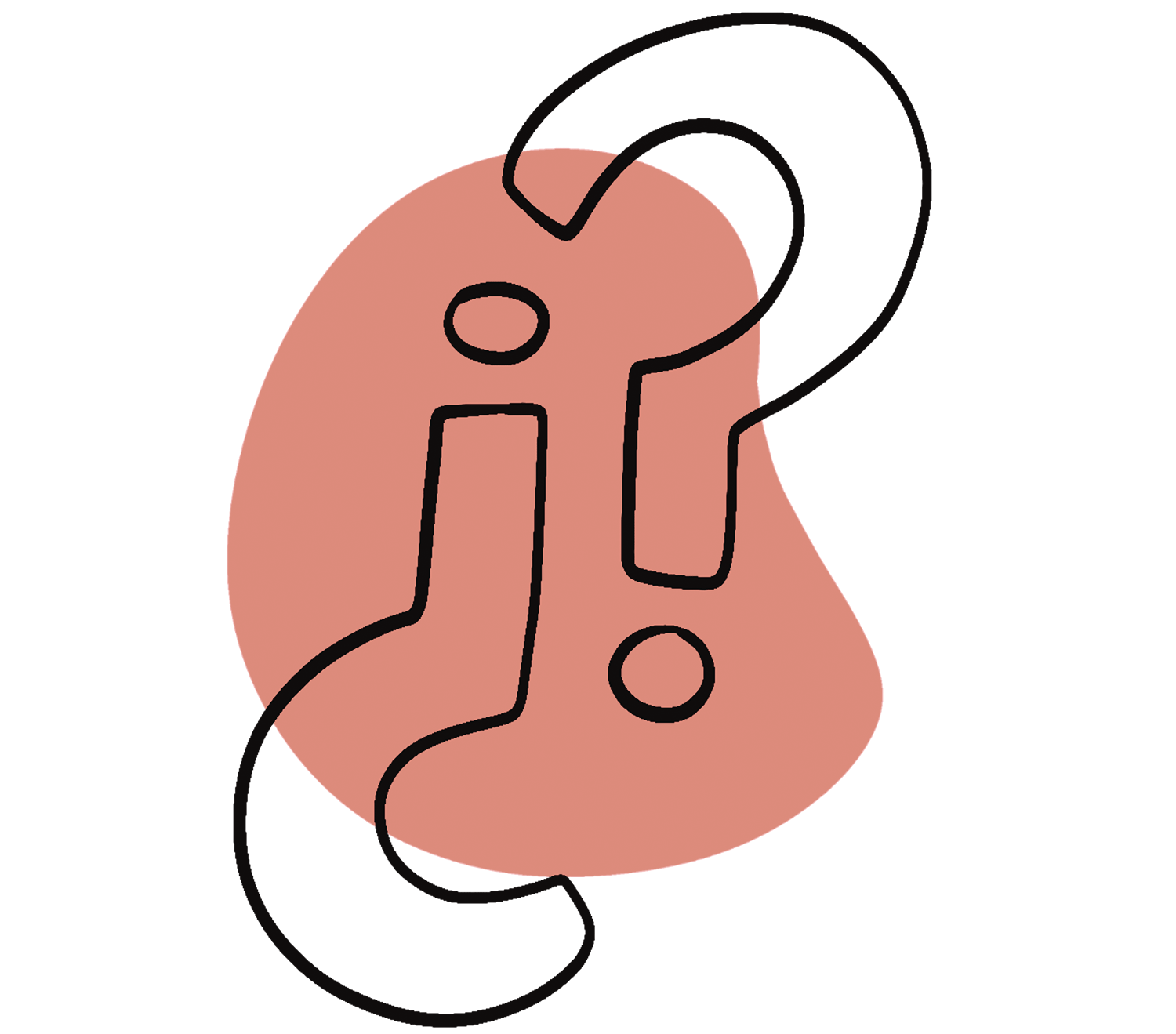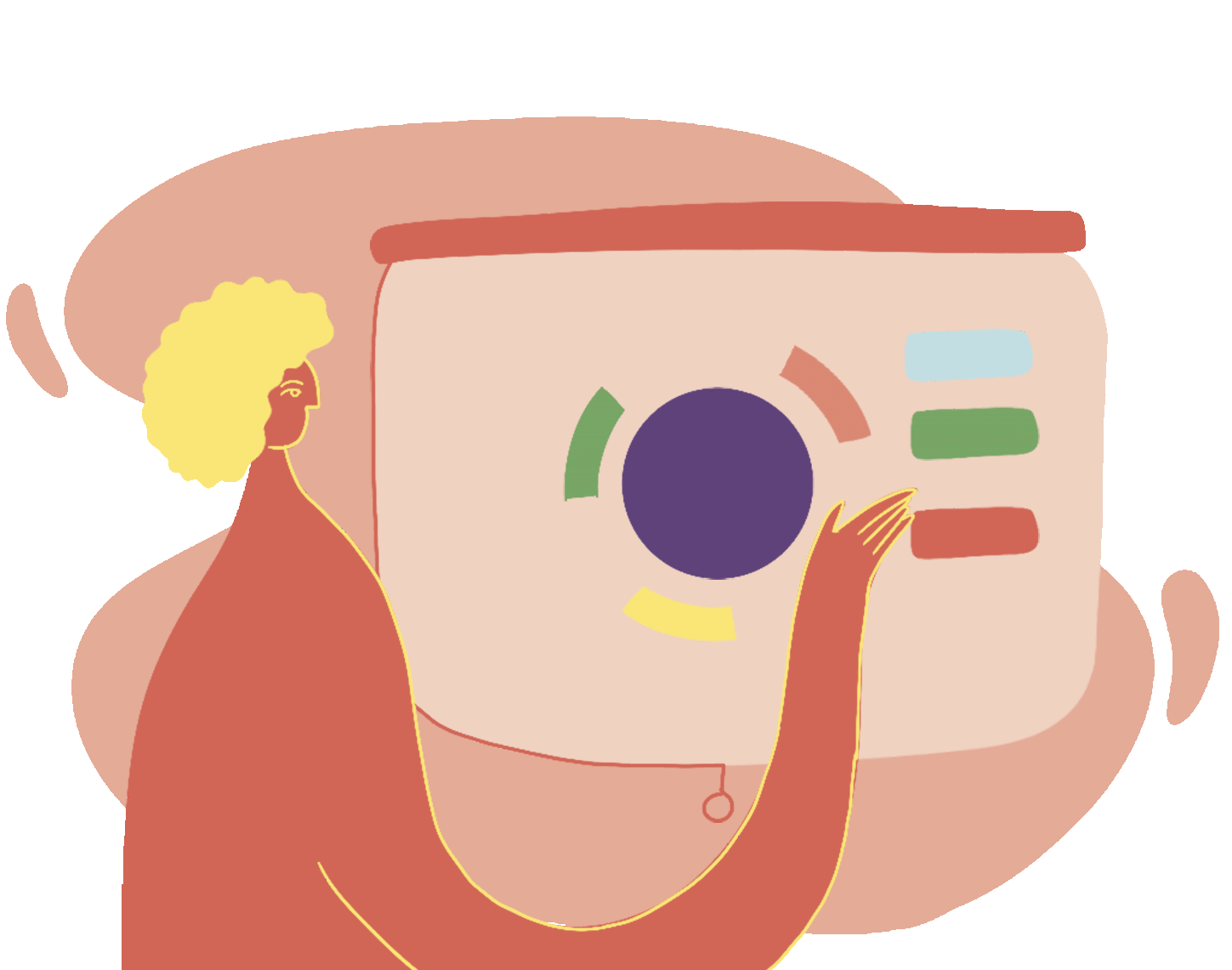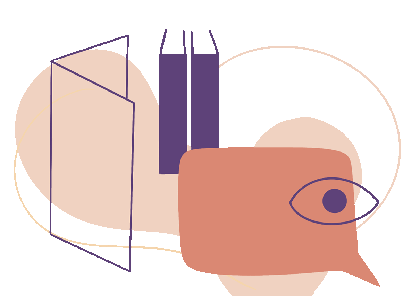Die Ausführungen in diesem Artikel beziehen sich auf den Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. Dr. Stefanie Müller, dem viele Lehrende der Fakultät Betriebswirtschaft (BW) folgen.
Müller (2012) empfiehlt die Verwendung von Fußnoten, um den Textfluss nicht zu beeinträchtigen. Alle Fußnoten werden am Seitenfuß gesammelt und aufgelistet.
Der Kurzbeleg in der Fußnote wird nach folgendem Muster gebildet:
Nachname (Jahr), Seitenangabe.
Beispiel:
„Jedes direkte Zitat muss im Text in Anführungszeichen gesetzt werden; der Zitatvermerk steht nach dem abschließenden Anführungszeichen.“ 23
23 Theisen (2009), S. 151.
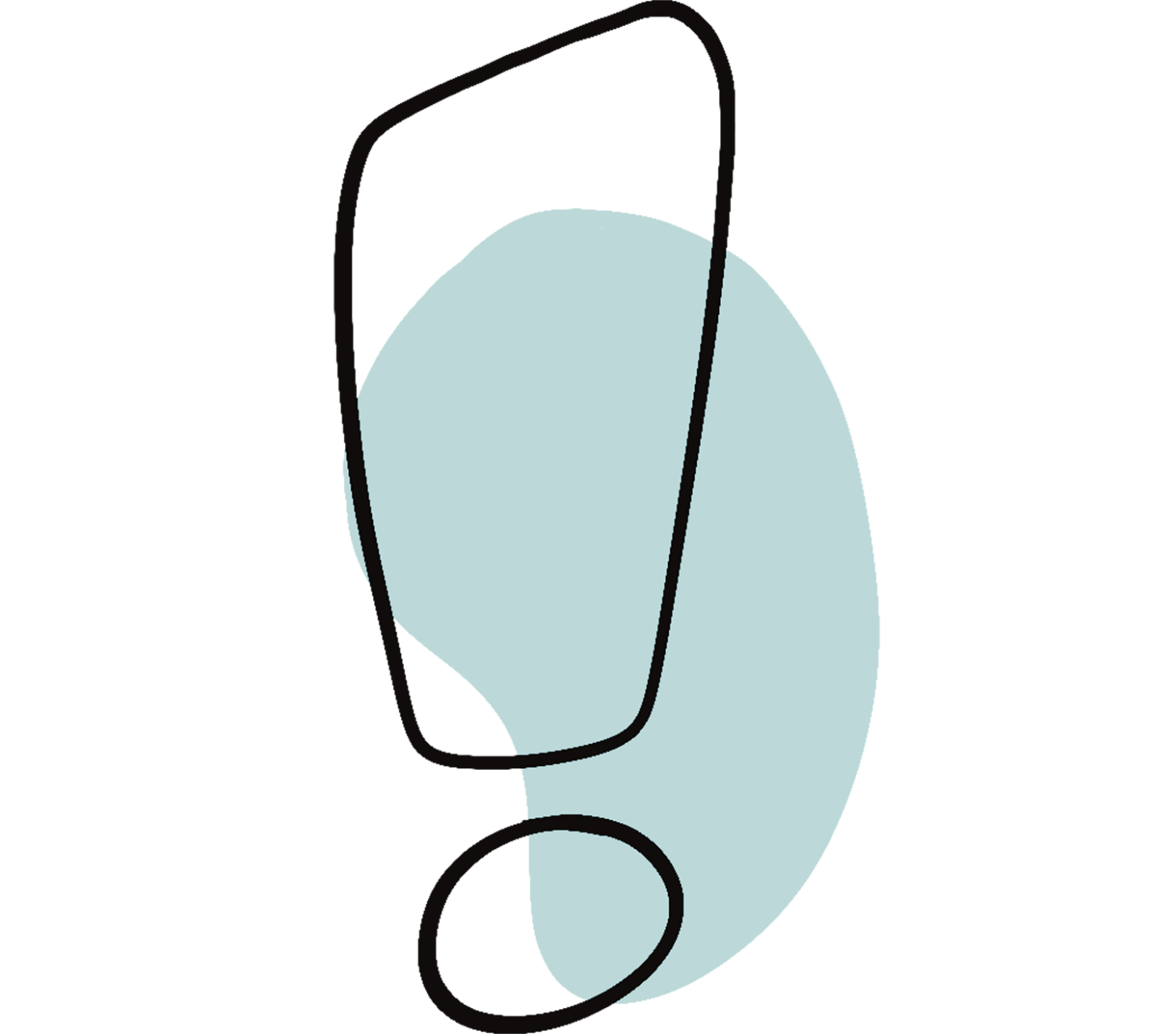
Grundsätzlich werden zwei Arten von Zitaten unterschieden: Das direkte (wörtliche) und das indirekte (sinngemäße) Zitat.

Bei direkten Zitaten übernimmst du den fremden Text unverändert in deinen Text, also auch in Bezug auf Rechtschreibung und Zeichensetzung. Dies machst du durch Anführungsstriche und den Beleg deutlich. Jede Änderung, Auslassung oder Korrektur von Fehlern ist durch eckige Klammern zu kennzeichnen.
Beispiel:
„Beim direkten Zitat werden die Ausführungen eines anderen Autors wörtlich im eigenen Text verwendet.“ 1
1 Müller (2012), S. 132.
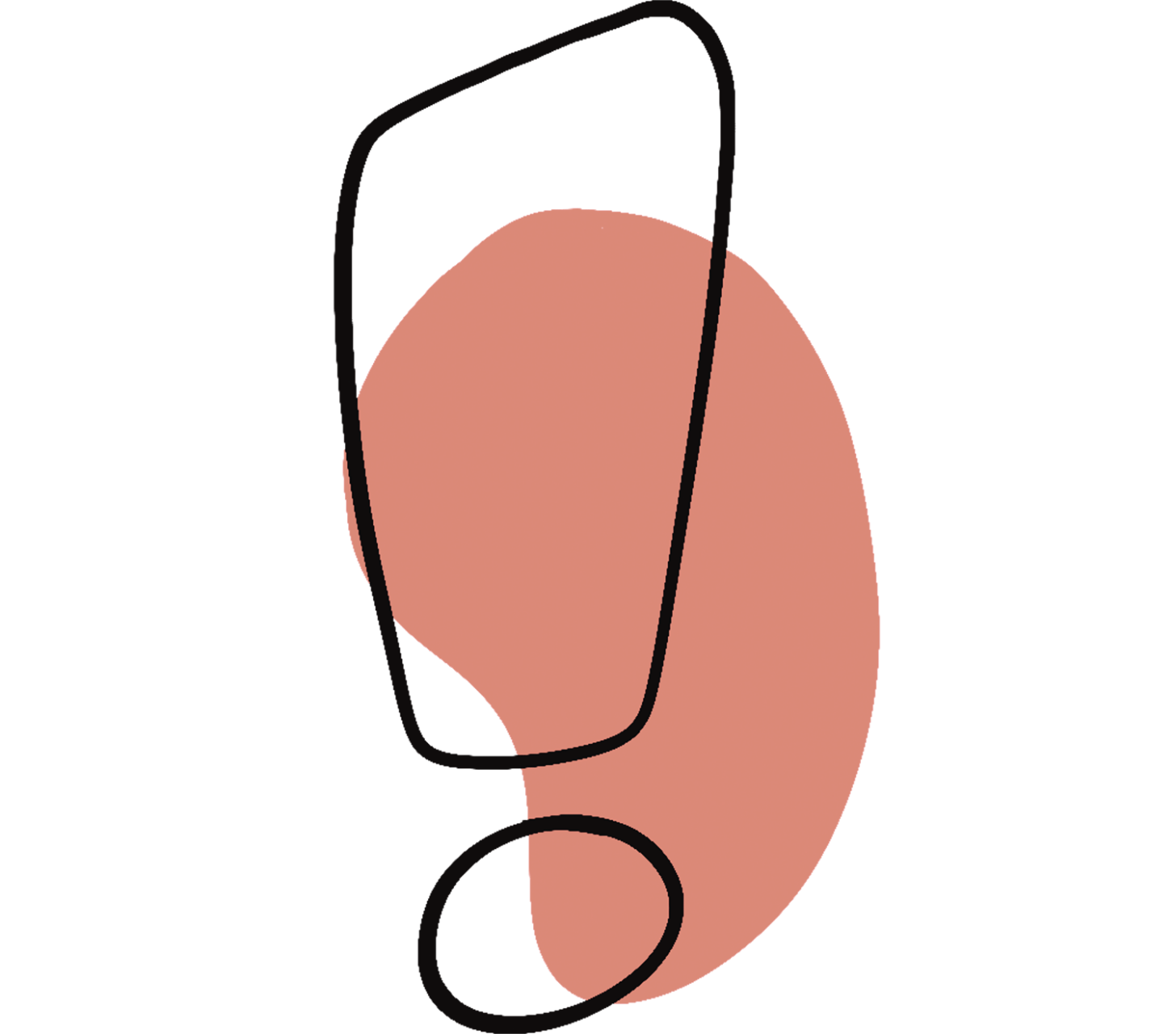
Bei indirekten Zitaten übernimmst du Gedanken, Ergebnisse, Aussagen etc. aus den Texten anderer, formulierst diese aber in eigenen Worten. Auch indirekte Zitate werden mit einem Kurzbeleg markiert, jedoch nicht in Anführungsstriche gesetzt. Der Kurzbeleg in der Fußnote beginnt mit „Vgl.“.
Beispiel:
Ein indirektes Zitat zeichnet sich dadurch aus, dass die Aussagen einer dritten Person – dem Sinne nach – in die eigene Ausfertigung übertragen werden. 1
1 Vgl. Müller (2012), S. 132.
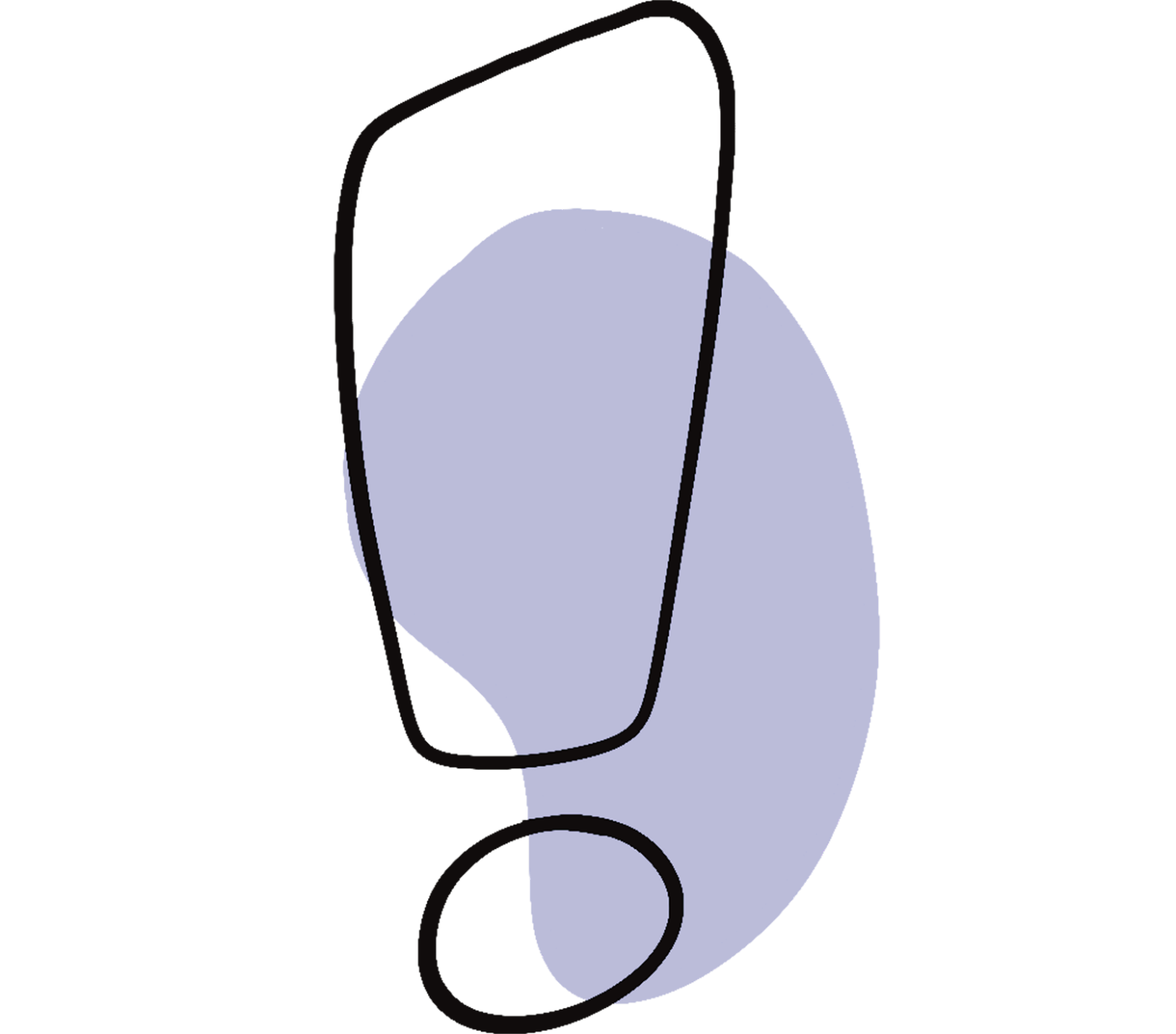
Sekundärzitate – also die Zitierung eines Zitates – solltest du vermeiden. Nur in Ausnahmefällen darf ein solches Zitat verwendet werden, z. B. wenn die Originalquelle nicht mehr zu beschaffen ist. Beide Quellen müssen im Literaturverzeichnis angegeben werden.
Beispiel:
Wenn du ein Sekundärzitat verwenden musst, gehören folgende Angaben in die Fußnote:
Nachname, Vorname (Jahr), Seitenangabe zitiert nach Nachname, Vorname (Jahr), Seitenangabe.
Werden mehr als zwei Autorinnen und Autoren benannt, ist hinter dem ersten Namen ein „et al.“ (lateinisch für „und andere“) zu platzieren.
Beispiel: Sterzenbach et al. (2009), S. 296.
Existieren mehrere Quellen einer Autorin oder eines Autors aus demselben Jahr, wird nach der Jahresangabe ein Buchstabe (alphabetisch absteigend) angehängt.
Beispiel: Aberle (2009a), S. 77. Aberle (2009b), S. 124.
Sind Ort oder Autorin bzw. Autor nicht ersichtlich, schreibst du „o. V.“ (ohne Verfassende) bzw. „o. O.“ (ohne Ort). Besser ist es jedoch – sollte der Autor oder die Autorin fehlen – die verantwortliche Organisation (Verein, Unternehmen, Institution etc.) zu nennen.
Beispiel: BMBF (2012), S. 34.
Ist die Jahres- oder Datumsangabe nicht ersichtlich, schreibst du „o. J.“ (ohne Jahr) bzw. „o. D.“ (ohne Datum).
Beispiel: Maier (o. J.), S. 99.
Zitierwürdig sind wissenschaftliche Publikationen:
- Monographien
- Sammelbände
- Datenbanken
- Wissenschaftliche Zeitschriften
Achtung! Folgende Quellen sind in der Regel nicht zitierwürdig:
- Das Vorlesungsskript
- Wikipedia
- Blogeinträge
- Internetseiten, die nicht dauerhaft aufrufbar sind
Siehe hierzu auch die Literatursuche nach Fakultäten oder unseren Artikel: Die richtigen Quellen nutzen.
Achtung: Nicht alle Treffer in einer Datenbank sind automatisch zitierwürdig. In der Datenbank WiSo kannst du z. B. entsprechende Filtereinstellungen vornehmen.
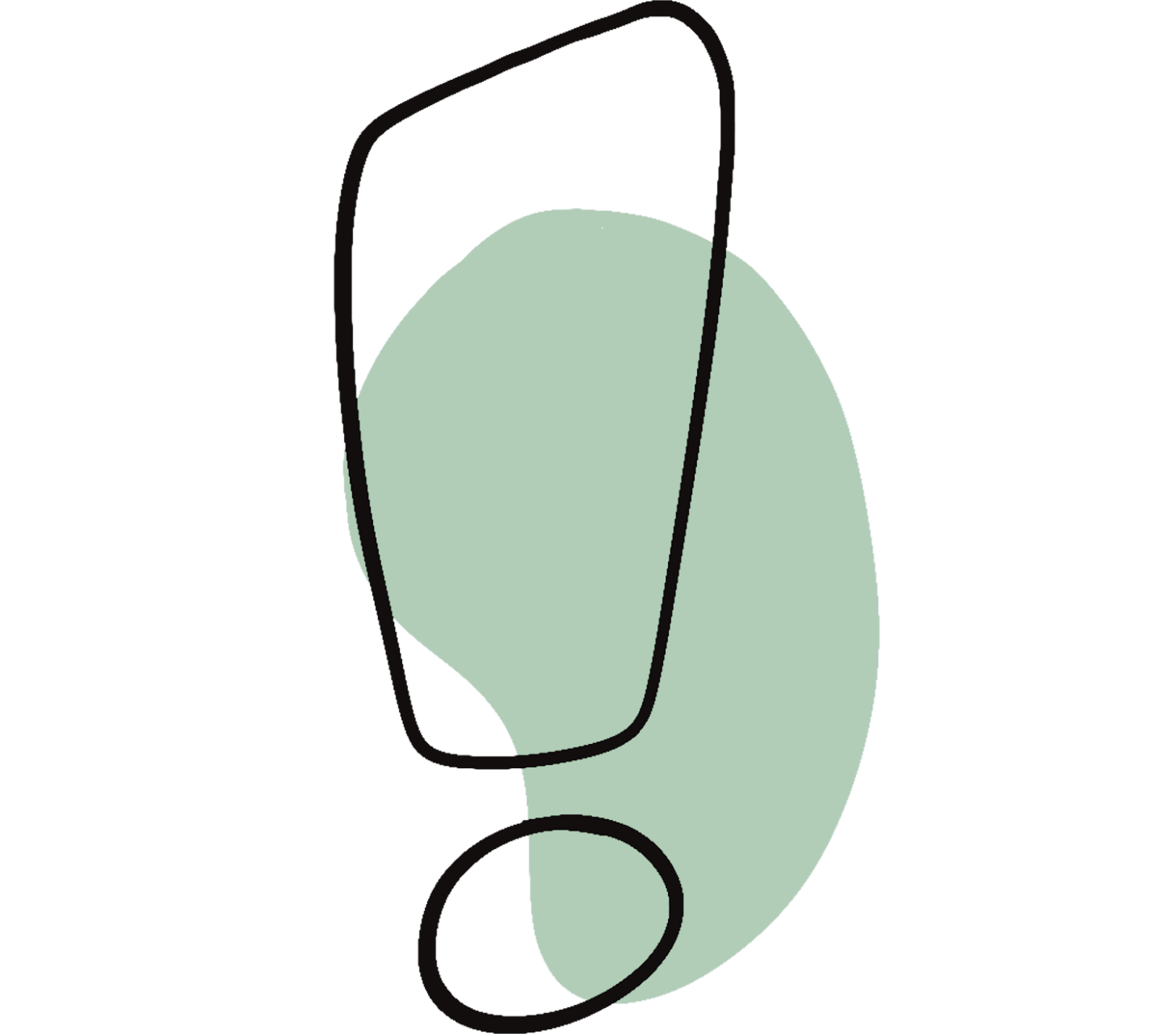
1. Monographien
Zitation in der Fußnote:
Nachname (Jahr), Seitenangabe.
Beispiel:
Bretzke/Barkawi (2012), S. 40.
Literaturverzeichnis:
Nachname (Jahr): Nachname, Vorname: Titel, Auflage, Verlagsort: Verlag, Jahr.
Beispiel:
Bretzke/Barkawi (2012): Bretzke, Wolf-Rüdiger; Barkawi, Karim: Nachhaltige Logistik. Antworten auf eine globale Herausforderung, 2. Auflage, Berlin; Heidelberg: Springer, 2012.
2. Zeitschriftenaufsätze & Beiträge in Zeitschriften
Zitation in der Fußnote:
Nachname (Jahr), Seitenangabe.
Beispiel:
Schäfer (2005), S. 6.
Literaturverzeichnis:
Nachname (Jahr): Nachname, Vorname: Titel des Aufsatzes/des Beitrags, in: Name der Zeitschrift, Jahrgang, Heftnummer (Jahr), Anfangsseite des Aufsatzes–Endseite des Aufsatzes.
Beispiel:
Schäfer (2005): Schäfer, Henry: Sustainability Balanced Scorecard als Managementsystem im Kontext des Nachhaltigkeitsansatzes – aktueller Stand und Perspektiven, in: Controlling, 4. Jg., Nr. 1 (2005), S. 5–14.
3. Beiträge in Sammelwerken, Lexika oder Handbüchern
Zitation in der Fußnote:
Nachname (Jahr), Seitenangabe.
Beispiel:
Michelsen (2007), S. 27.
Literaturverzeichnis:
Nachname (Jahr): Nachname, Vorname: Titel des Beitrages, in: Nachname, Vorname (Hrsg.): Titel des Sammelwerks/Lexikons/Handbuchs, Auflage, Verlagsort: Verlag, Jahr, Anfangsseite des Beitrags–Endseite des Beitrags.
Beispiel:
Michelsen (2007): Michelsen, Gerd: Nachhaltigkeitskommunikation: Verständnis – Entwicklung – Perspektiven, in: Michelsen, Gerd; Godemann, Jasmin (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation – Grundlagen und Praxis, 2. Auflage, München: Oekom, 2007, S. 25–41.
4. Onlinedokumente & Webseiten
Zitation in der Fußnote:
Nachname/Organisation online (Jahr).
Beispiel:
The World Bank online (2013).
Literaturverzeichnis:
Nachname/Organisation online (Jahr): Titel, URL, Zugriff am TT. Monat JJJJ.
Beispiel:
The World Bank online (2013): Population (Total), https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?or-der=wbapi_data_value_2012, Zugriff am 19. März 2021.

Welcher Zitierstil wird in der Fakultät BW empfohlen?
Müller (2012) empfiehlt die Verwendung von Fußnoten, um den Textfluss nicht zu beeinträchtigen. Alle Fußnoten werden am Seitenfuß gesammelt und aufgelistet.
Wie setze ich direkte Zitate ein?
Bei direkten Zitaten übernimmst du den fremden Text unverändert, machst dies jedoch durch Anführungsstriche und den Beleg deutlich. Alle Änderungen am Text werden durch eckige Klammern gekennzeichnet.
Worauf muss ich bei indirekten Zitaten achten?
Bei indirekten Zitaten übernimmst du Gedanken, Ergebnisse, Aussagen etc. aus den Texten anderer, formulierst diese aber in eigenen Worten. Auch indirekte Zitate werden mit einem Kurzbeleg markiert, jedoch nicht in Anführungsstriche gesetzt. Der Kurzbeleg in der Fußnote beginnt mit „Vgl.“.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.