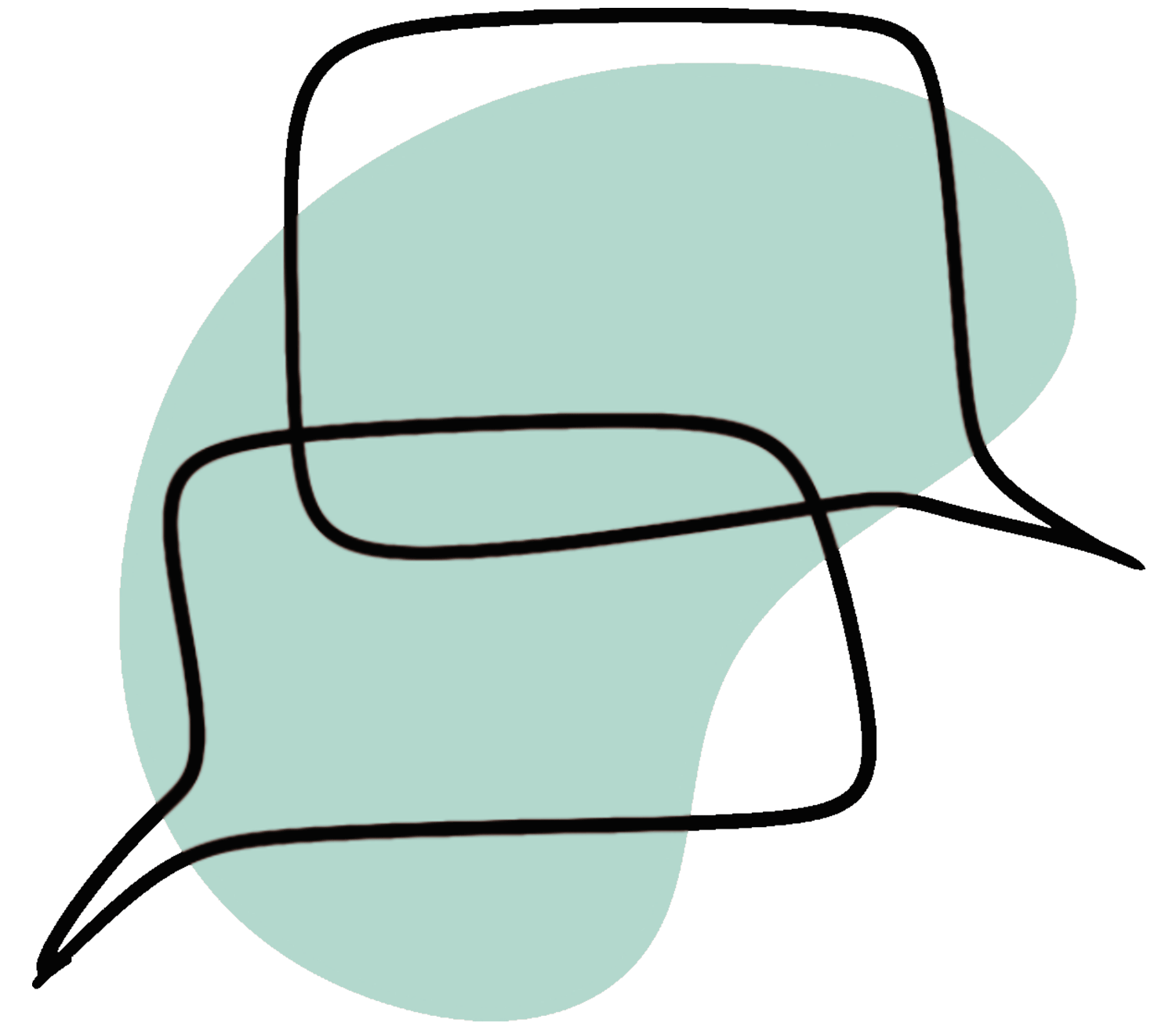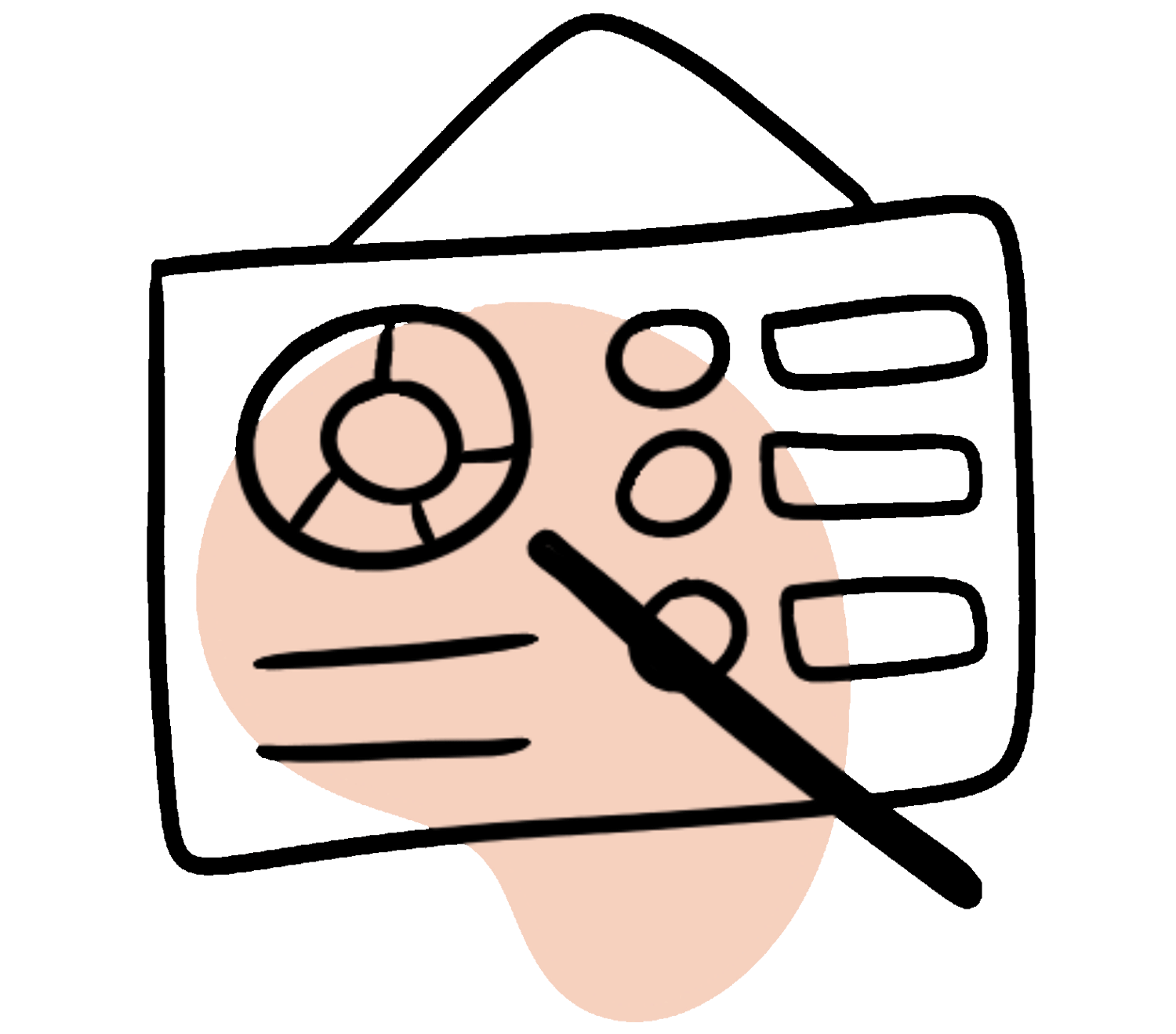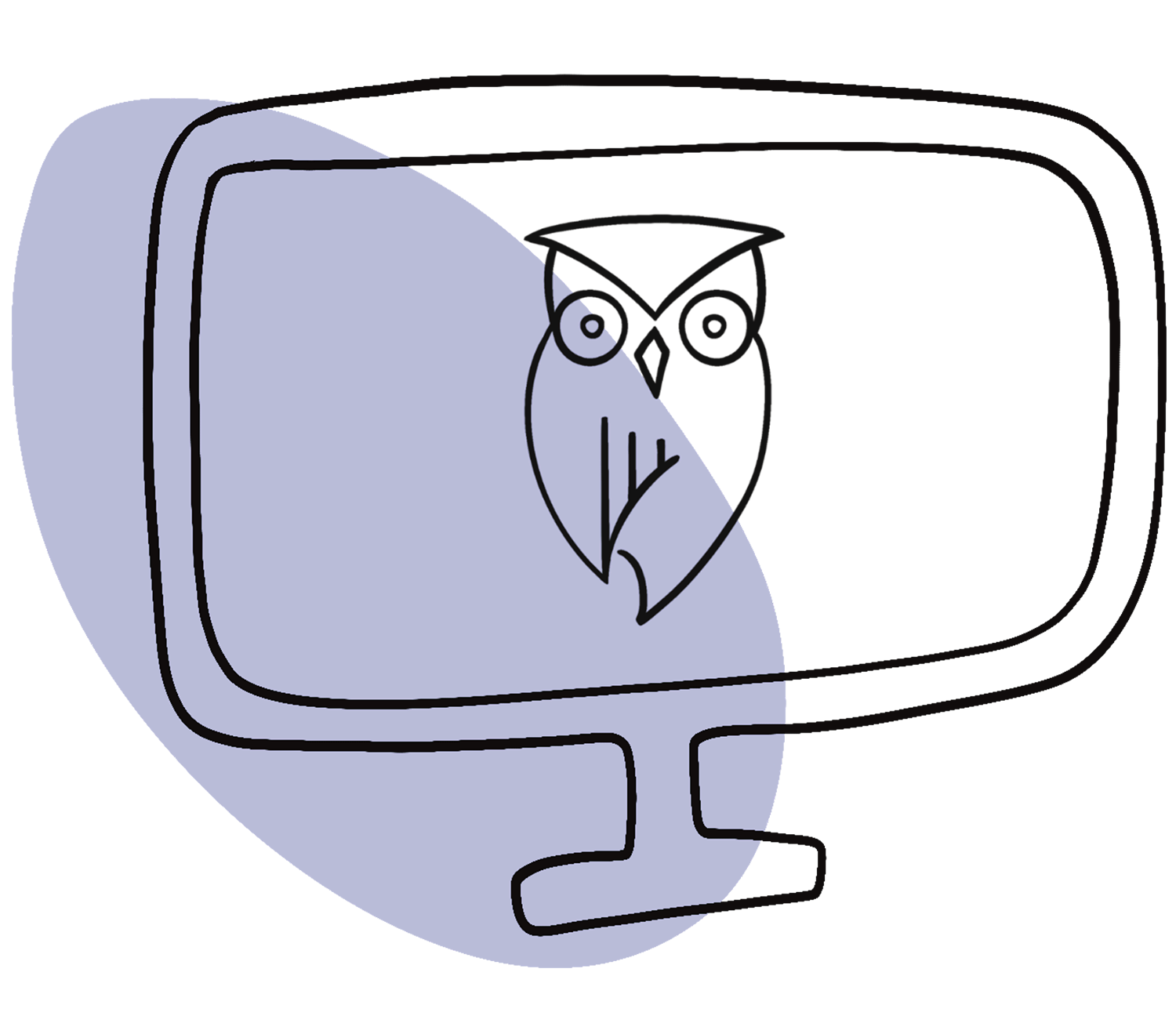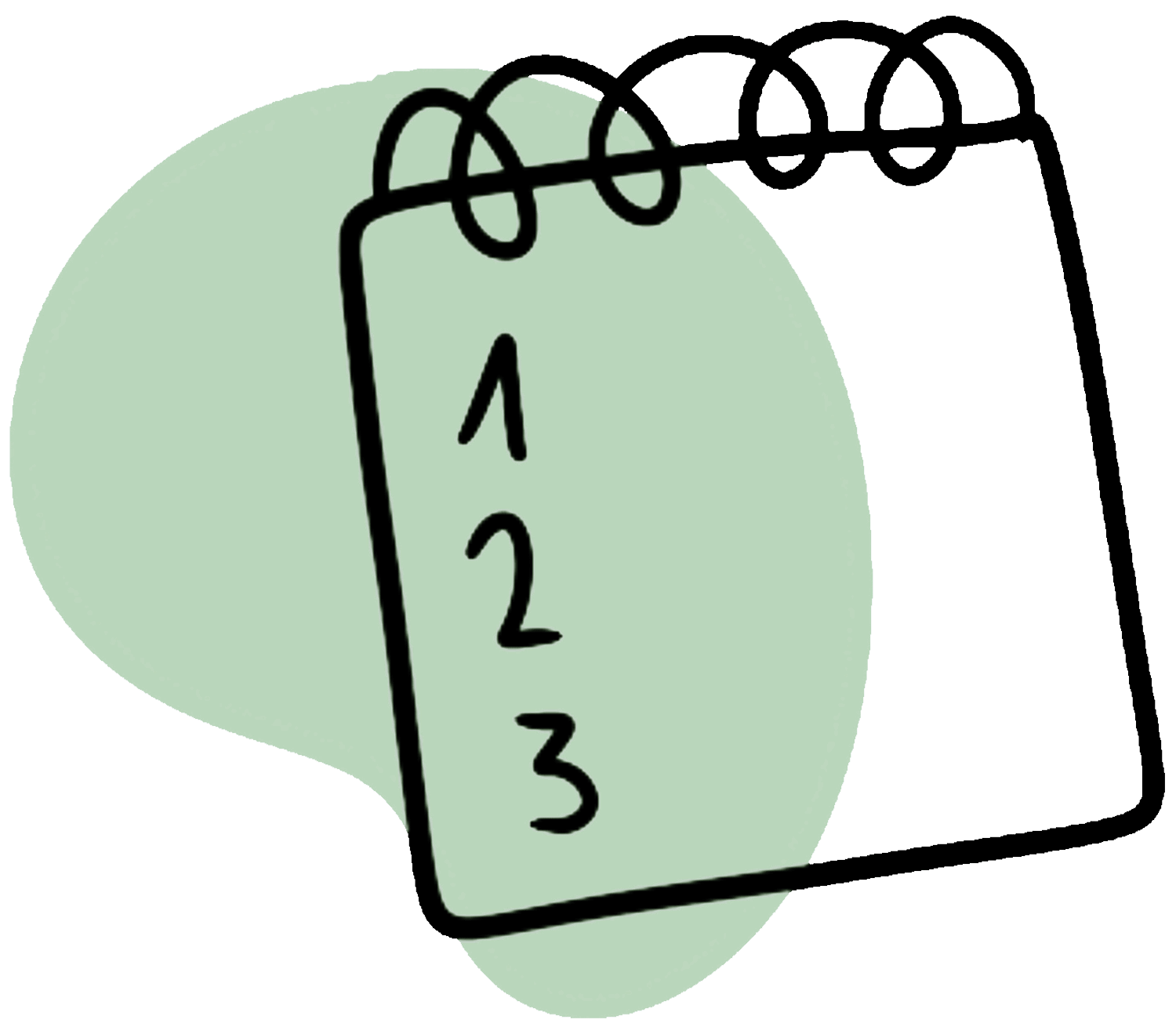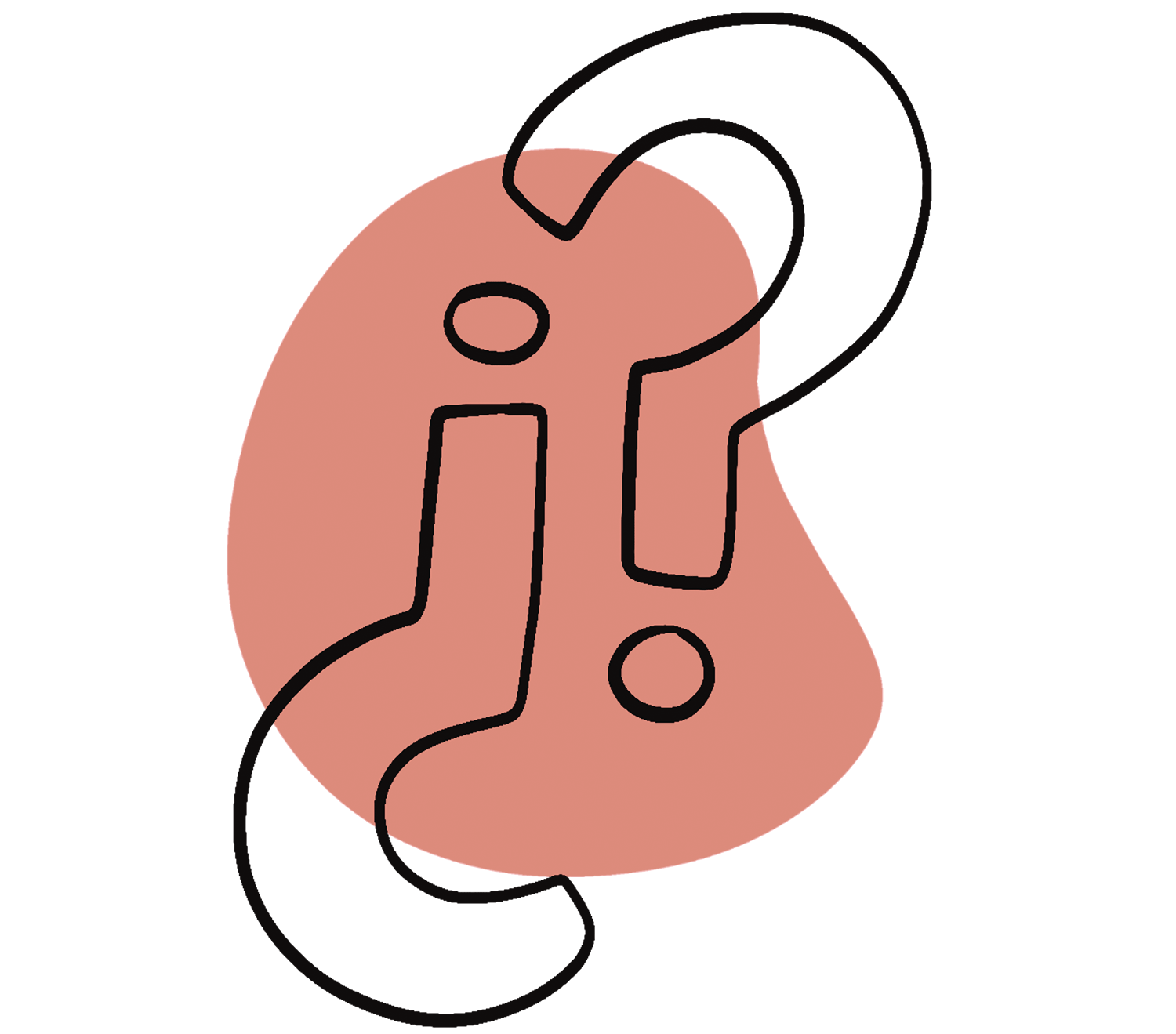Es gibt nicht die eine richtige Wissenschaftssprache, sondern innerhalb eines Feldes eine dynamische Spannbreite an Möglichkeiten. Grundsätzlich ist die Sprache in wissenschaftlichen Texten in der Regel jedoch:
- sachbezogen
- belegt
- neutral
- präzise und eindeutig
- kurz und prägnant
- formal
Schreibe über Inhalte, die an der jeweiligen Stelle für deine Fragestellung relevant sind.
Beispiel
Je nach Ausbildung, Beruf, sozialer Lage und Familienstand sind die Möglichkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterschiedlich.
Nicht: Familie und Beruf zu vereinbaren ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein schwieriger Balanceakt. Zwar können die Betriebe mit Telearbeit oder mobilem Arbeiten Alternativen zum Arbeiten außerhalb des Büros für ihre Beschäftigten schaffen, allerdings sind die Möglichkeiten der Arbeitskräfte für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf je nach Ausbildung, Beruf, sozialer Lage und Familienstand sehr unterschiedlich.
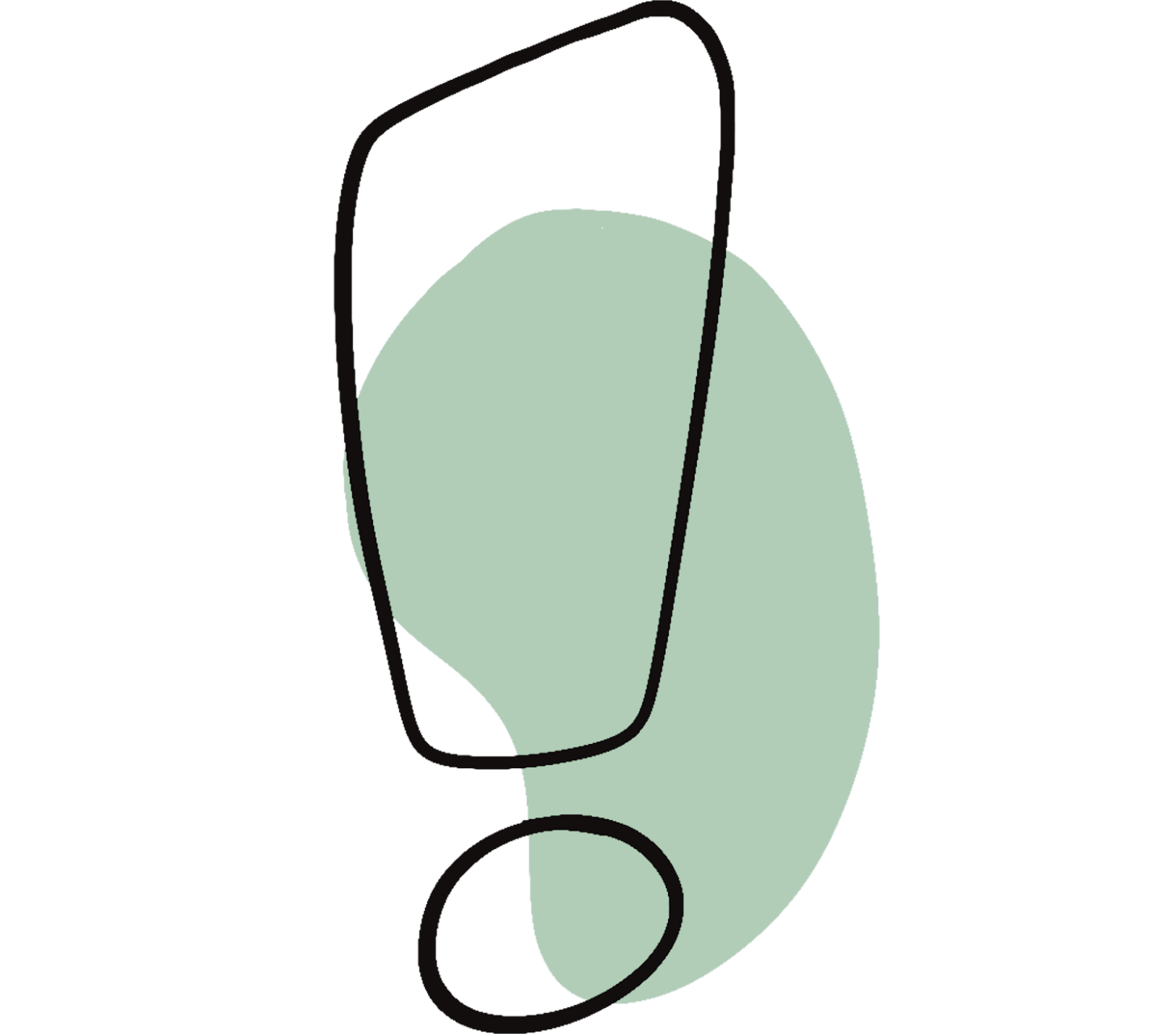
Präsentiere Erkenntnisse, die nachprüfbar und belegbar sind. Stelle keine Vermutungen an. Behauptungen sind als solche zu kennzeichnen.
Beispiel
Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse (2013, S. 14) essen 60 Prozent der unter 25-Jährigen mindestens einmal in der Woche Fertiggerichte.
Nicht: Studien von Krankenkassen ergaben, dass junge Erwachsene sich schlecht ernähren.

Vermeide wertende Formulierungen. Wenn du Wertungen vornimmst, muss dies an geeigneter Stelle und explizit erfolgen, z.B. im Fazit.
Beispiel
Müller (2012, S. 4) zeigt jedoch, dass die Kriminalitätsrate zwischen 1992 und 2012 gestiegen ist. Dies ist laut einer Studie des Bundeskriminalamtes (2013, S. 55) auf die steigende Verbreitung von Schusswaffen zurückzuführen.
Nicht: Müller (2012, S. 34) zeigt jedoch, dass die Kriminalitätsrate in den letzten 20 Jahren leider gestiegen ist. Dies ist wahrscheinlich laut einer Studie des Bundeskriminalamtes (2013, S. 55) auf die viel zu hohe Verbreitung von Schusswaffen zurückzuführen.
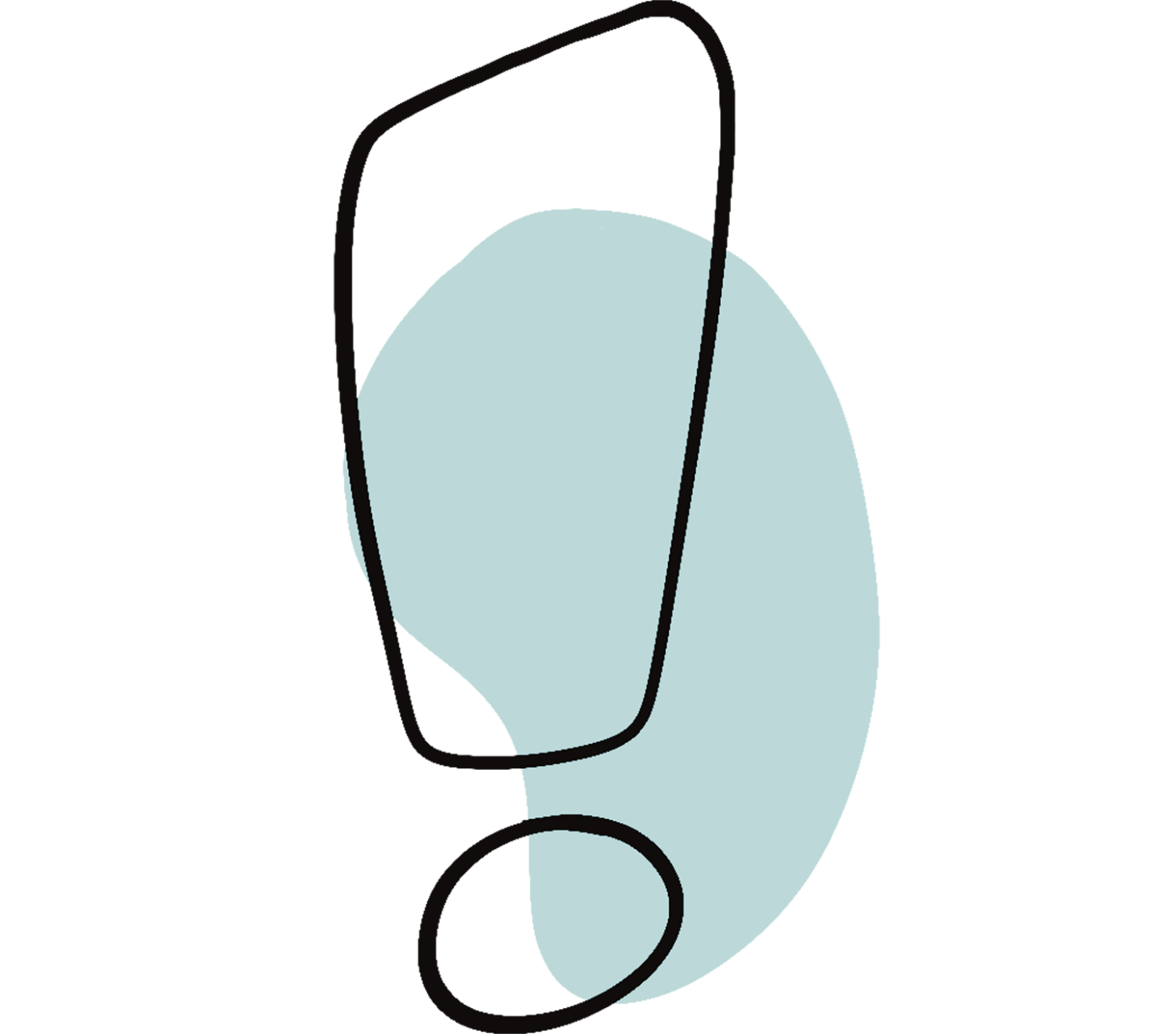
Vermeide lange Umschreibungen, wenn du das Gewünschte mit einem Fachbegriff ausdrücken kannst. Auch wenn eine verständliche Sprache gefordert ist, gilt: Du schreibst eine Studienarbeit für ein Fachpublikum. So wirst du auch in der späteren Praxis Texte verfassen müssen, die von Fachleuten gelesen werden, und die nicht jeder Laie verstehen können muss, wie z.B. Gutachten oder Konzeptionen.
Fachbegriffe sollten jedoch eingeführt und ggf. definiert werden, sofern diese nicht eindeutig geläufig sind.
Beispiel
Aus diesen Gründen empfehlen Experten Ganztagsschulen.
Nicht: Aus diesen Gründen empfehlen Experten Schulen, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst.
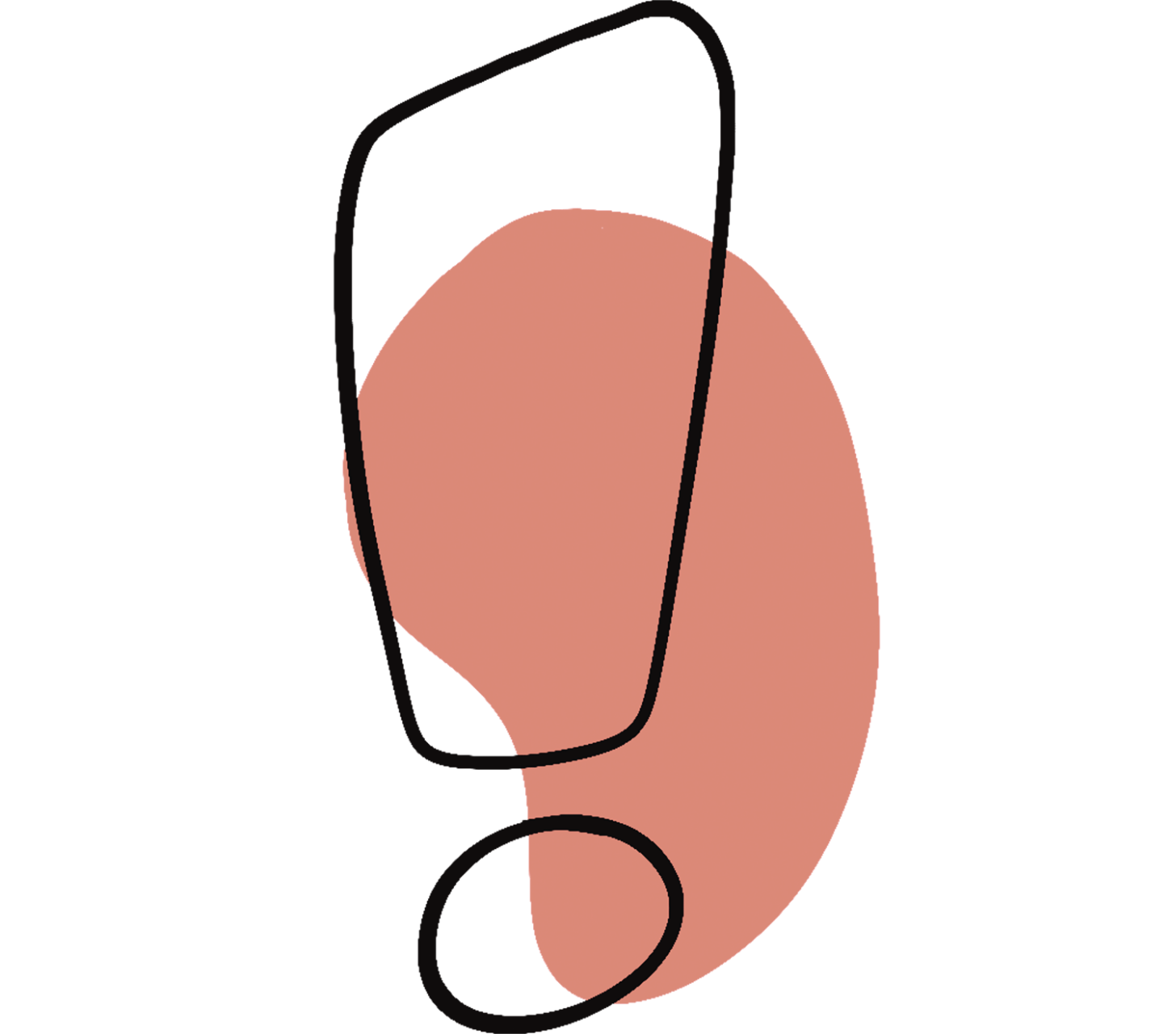
Wissenschaftliche Texte sind Arbeitsdokumente, die gut verständlich zu lesen sein sollten. Formuliere deshalb so kurz und prägnant wie möglich, und verstecke deine Aussagen nicht hinter unnötig komplizierten Wörtern und Wendungen.
Beispiel 1
Die deutsche Bildungs- und damit die Schullandschaft ist vielfältig und teilweise unübersichtlich organisiert. Was mit dem Begriff Ganztagsschule bezeichnet wird, unterscheidet sich inhaltlich, organisatorisch und regional.
Nicht: Die Schullandschaft ist als Teil der Bildungslandschaft in Deutschland heutzutage sehr vielfältig und teilweise auch unübersichtlich organisiert. Wenn man sich mit dem Thema „Ganztagsschule“ beschäftigt, wird schnell deutlich, dass es „die“ Ganztagsschule nicht gibt. Inhaltlich und organisatorisch, sowie regional in den Bundesländern und Kommunen, gibt es große Unterschiede. Bevor also über dieses Thema gesprochen werden kann, sollte erst einmal eine Begriffsklärung stattfinden.
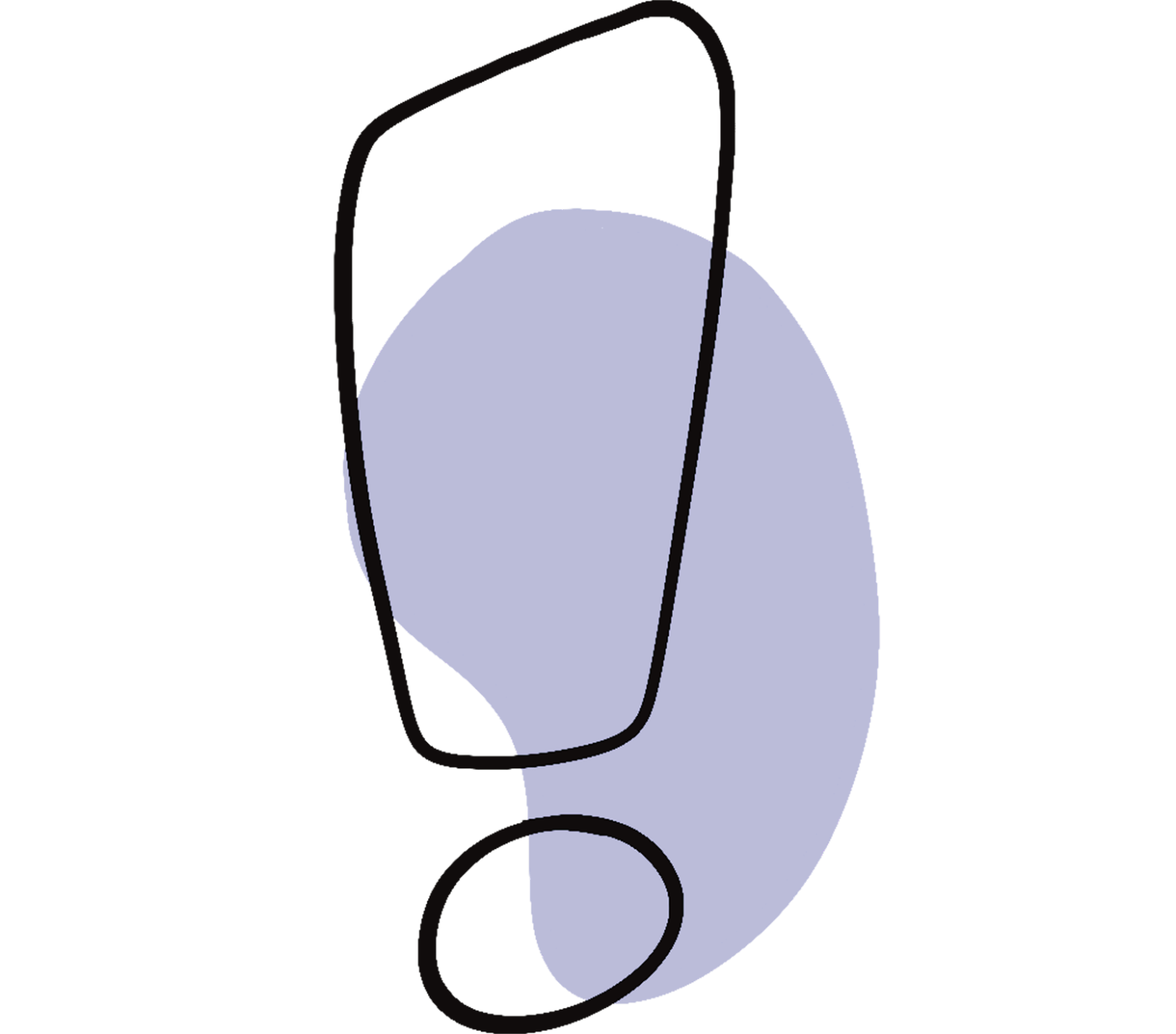
Beispiel 2
Musiktherapie ist eine Möglichkeit, dem Menschen als Individuum zu begegnen. Jeder Mensch nimmt Musik anders wahr, weshalb die Musiktherapie nicht alle Menschen anspricht. Durch den Anteil an Improvisation liefert sie jedoch die Möglichkeit, individuell auf den Einzelnen und seine Fähigkeiten einzugehen. Deshalb kann Musiktherapie gängige Therapieformen sinnvoll ergänzen.
Nicht: Musiktherapie ist eine Möglichkeit, dem Menschen als Individuum zu begegnen und einen Anstoß zu geben. Dabei muss auch nicht jeder auf die musikalische Therapie anspringen, jeder Mensch hat schließlich einen anderen Bezug zur Musik. Durch den großen Anteil der Improvisation liefert sie jedoch eine unglaublich faszinierende Möglichkeit, individuell auf den Menschen und seine Fähigkeiten einzugehen. Deshalb ist diese Form der Musiktherapie bereits jetzt eine Methode, die ergänzend zu gängigen Therapieformen sehr sinnvoll ist und Hoffnung geben kann.
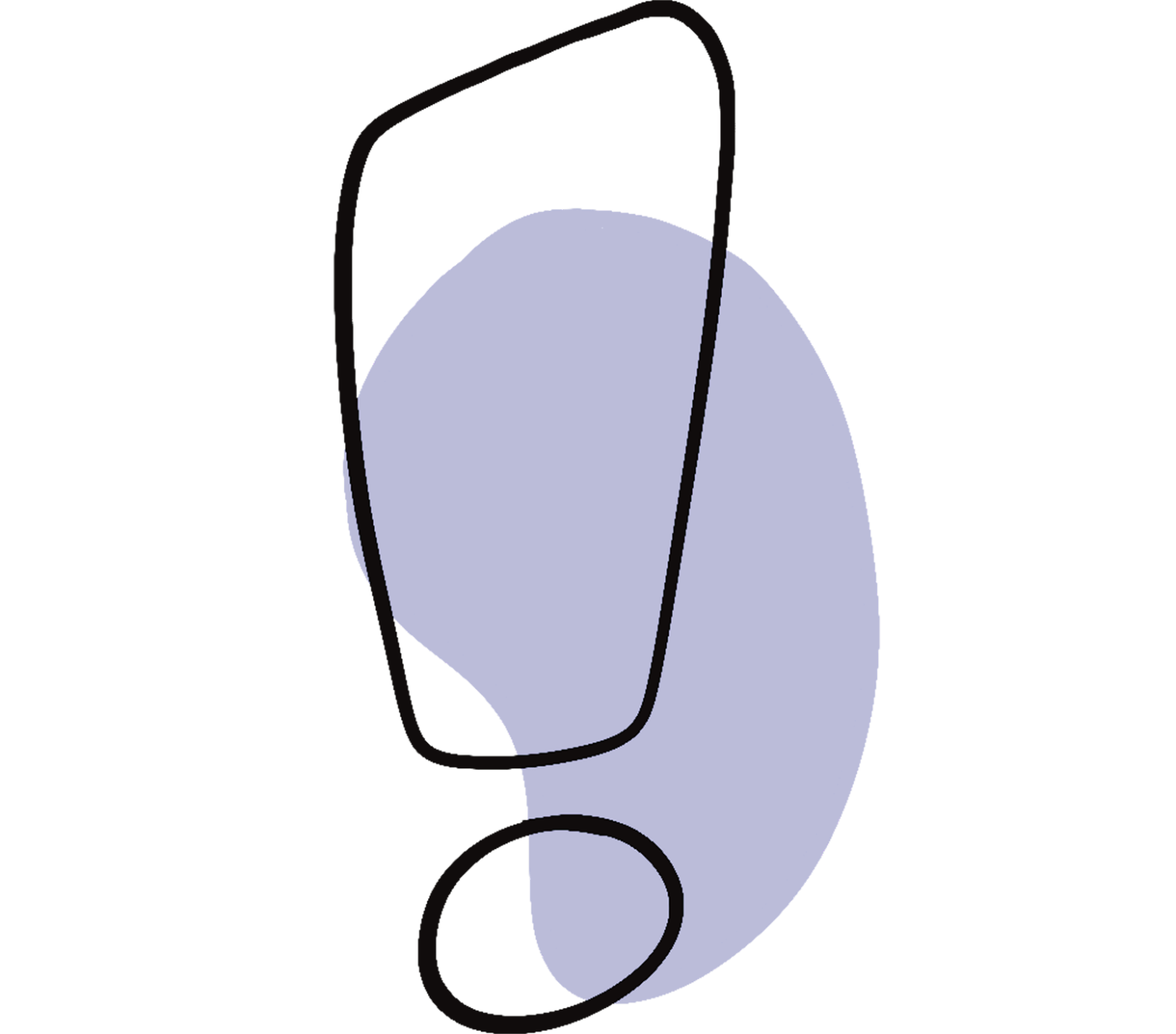
Beispiel 3
Die Anzahl der Plätze in Übergangsheimen ist begrenzt.
Nicht: Die Plätze in Übergangsheimen unterliegen einer quantitativen Begrenzung.
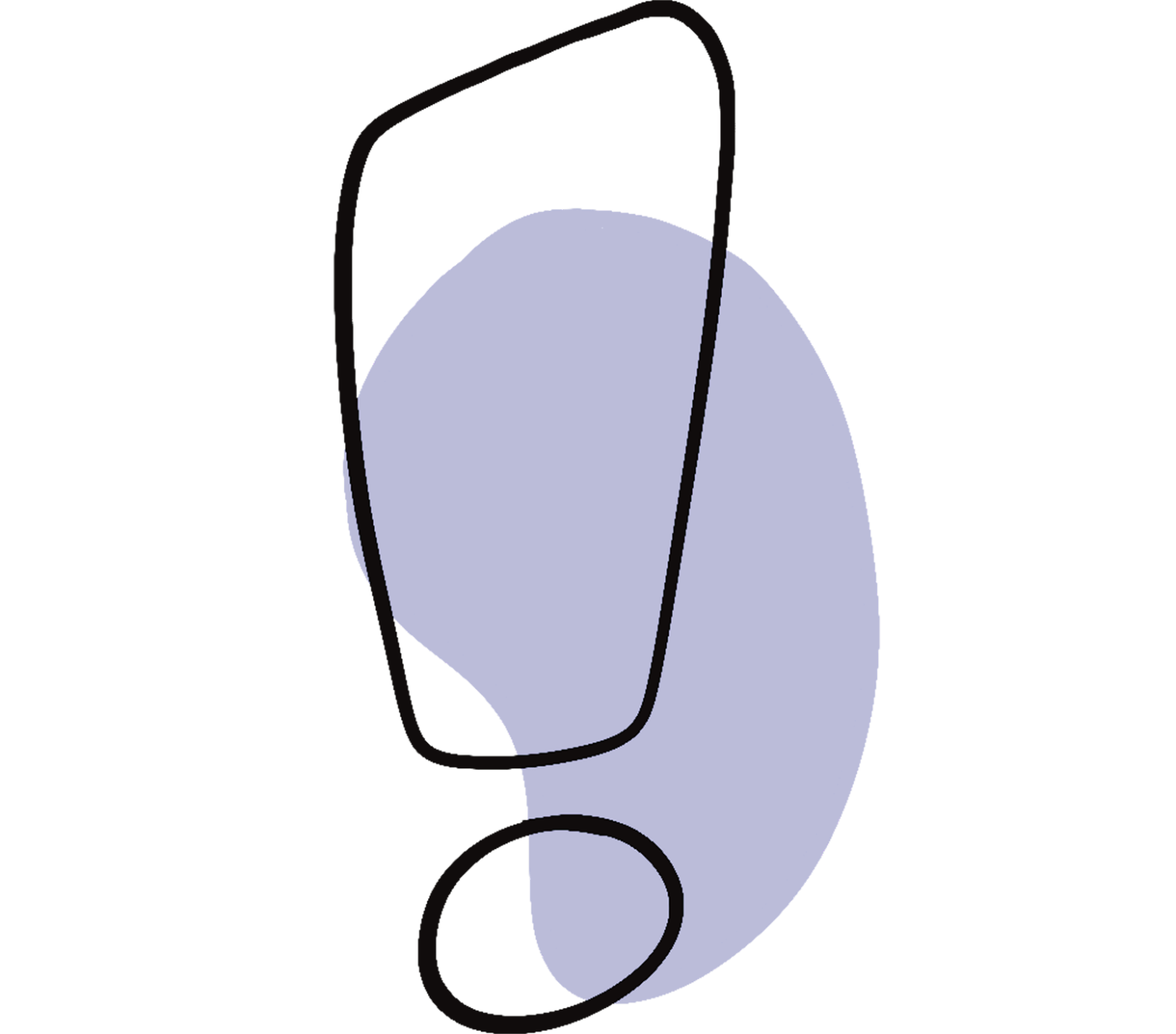
Von wissenschaftlichen Texten wird ein gewisses Maß an Formalität erwartet. Vermeide daher Umgangssprache, Jargon und Werbesprache. Nutze jedoch ebenso keine übertrieben förmliche Sprache.
Beispiel 1
In Justizvollzugsanstalten sind straffällig gewordene Menschen inhaftiert.
Nicht: In Justizvollzugsanstalten sind Menschen inhaftiert, die ihr Leben dem Verbrechen dezidiert haben.
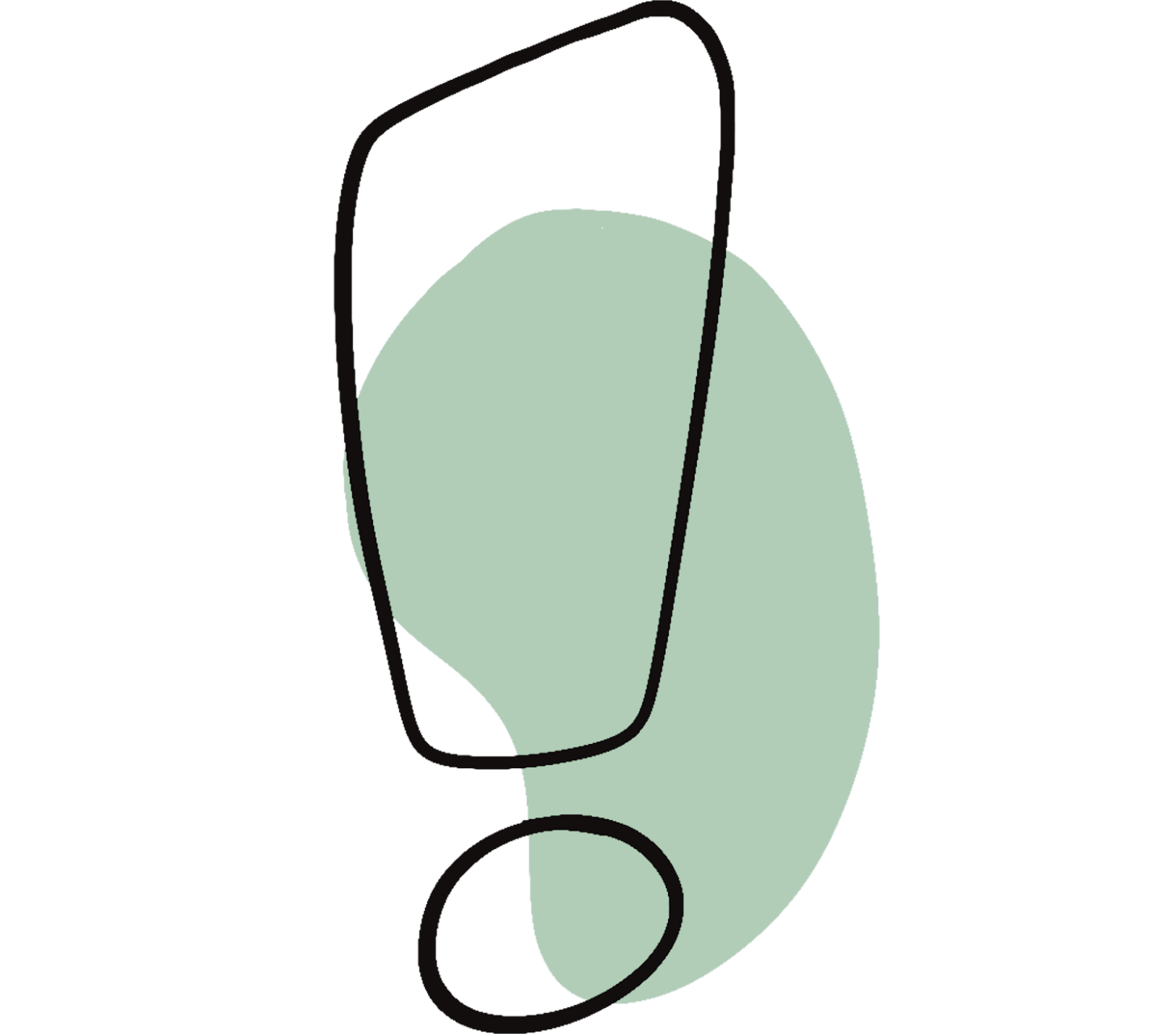
Beispiel 2
Die Jugendlichen in dieser Schule tragen häufig verschlissene Kleidung.
Nicht: Die Jugendlichen in dieser Schule tragen häufig alte und schäbige Klamotten.
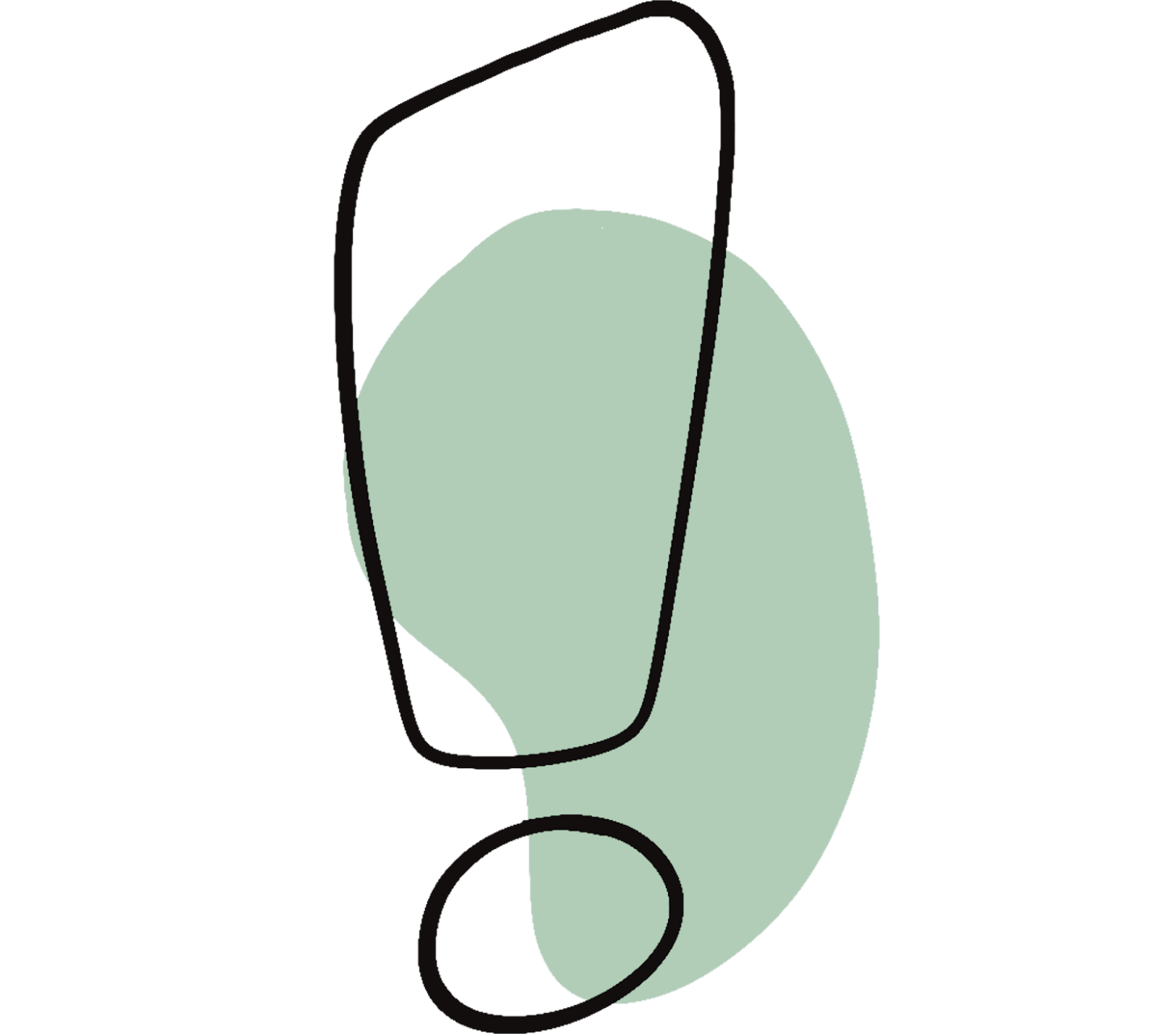
Beispiel 3
Das Programm FIT UND AKTIV für Senioren besteht seit 1946.
Nicht: Die Erfolgsstory von FIT UND AKTIV begann vor ca. 70 Jahren.
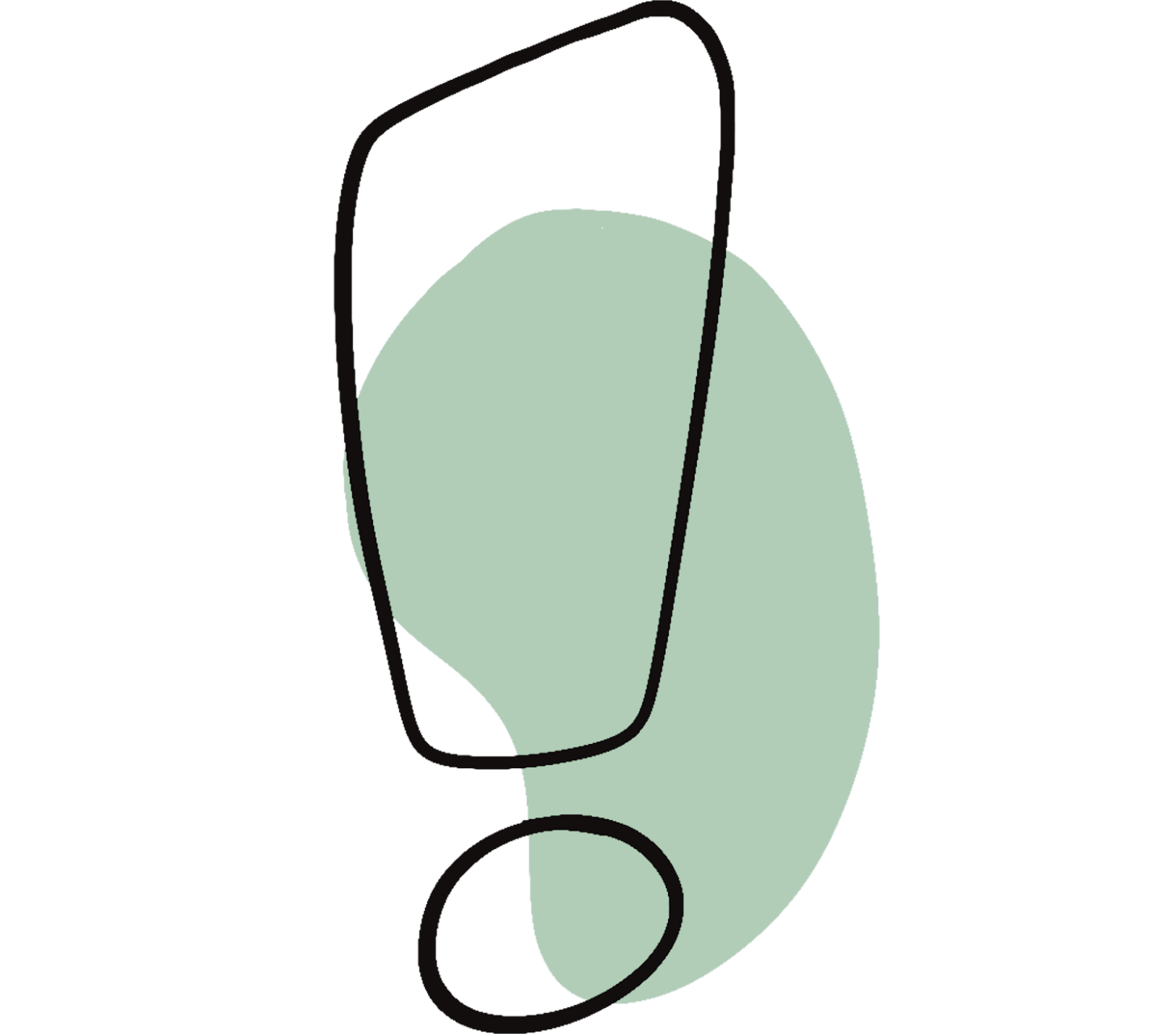
Jeder Text, der im Rahmen des Studiums und des Berufs verfasst wird, sollte zudem Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik korrekt anwenden. Dies gilt insbesondere für wissenschaftliche Arbeiten. Ein Übermaß an formalen Fehlern kann die Lesenden und die Prüfenden auch an deiner sonstigen Sorgfalt zweifeln lassen, z. B. an deinem wissenschaftlichen Arbeiten.

Es ist normal, im Laufe des Schreibens textblind zu werden, und selbst offensichtliche Fehler immer wieder zu überlesen.
Was macht Wissenschaftssprache aus?
Auch wenn es fachspezifische Unterschiede gibt, ist die Sprache in allen wissenschaftlichen Texten i. d. R.: Sachbezogen, belegt, neutral, präzise, eindeutig, kurz, prägnant und formal.
Wie kann ich meinen wissenschaftlichen Schreibstil verbessern?
Um deinen wissenschaftlichen Schreibstil kontinuierlich zu verbessern, empfehlen wir, regelmäßig Fachliteratur zu lesen, besonders in deinem Forschungsbereich, und Text-Feedback von deinen Lehrenden und Mitstudierenden einzuholen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im März 2025 und zuletzt aktualisiert im März 2025.