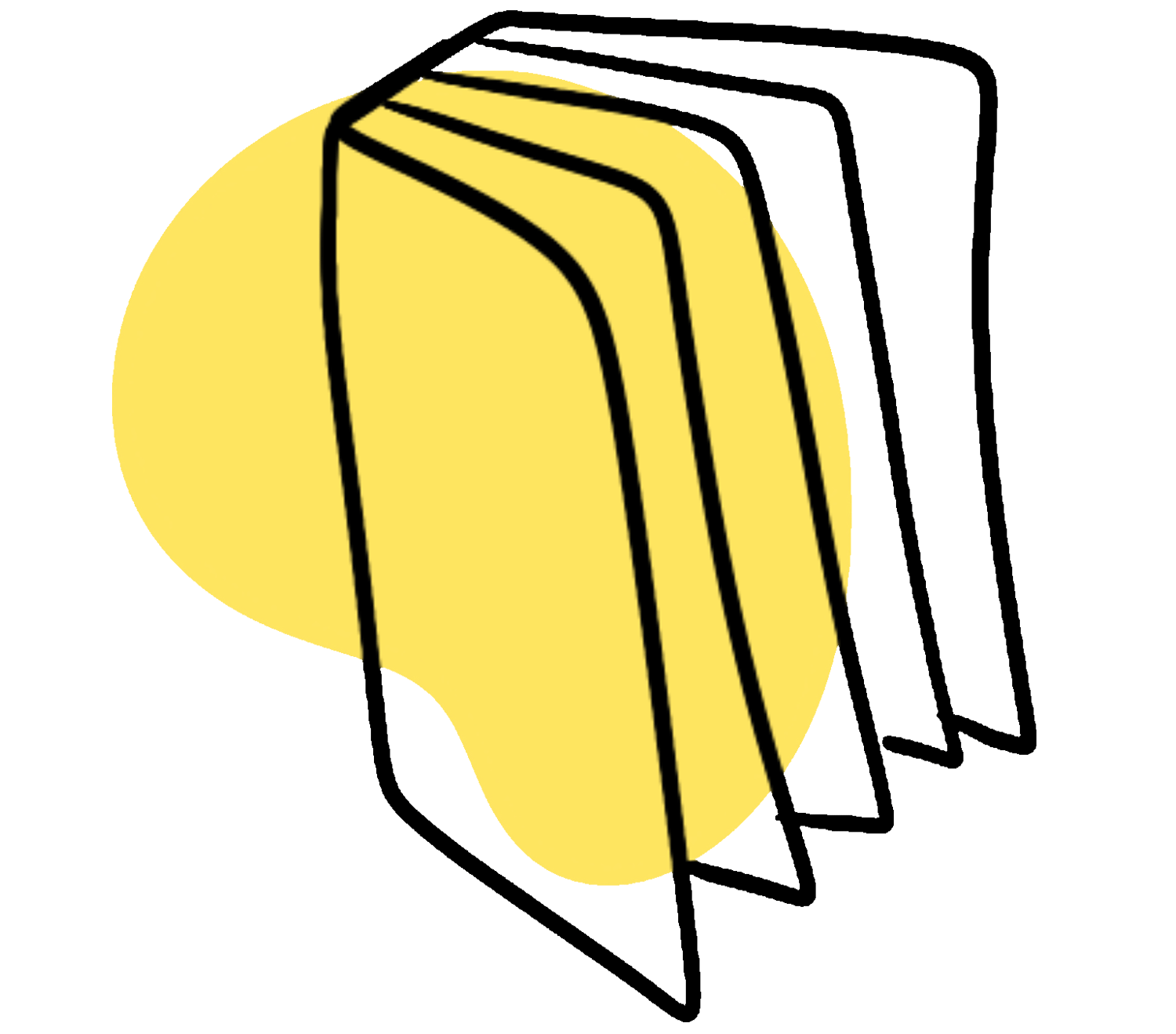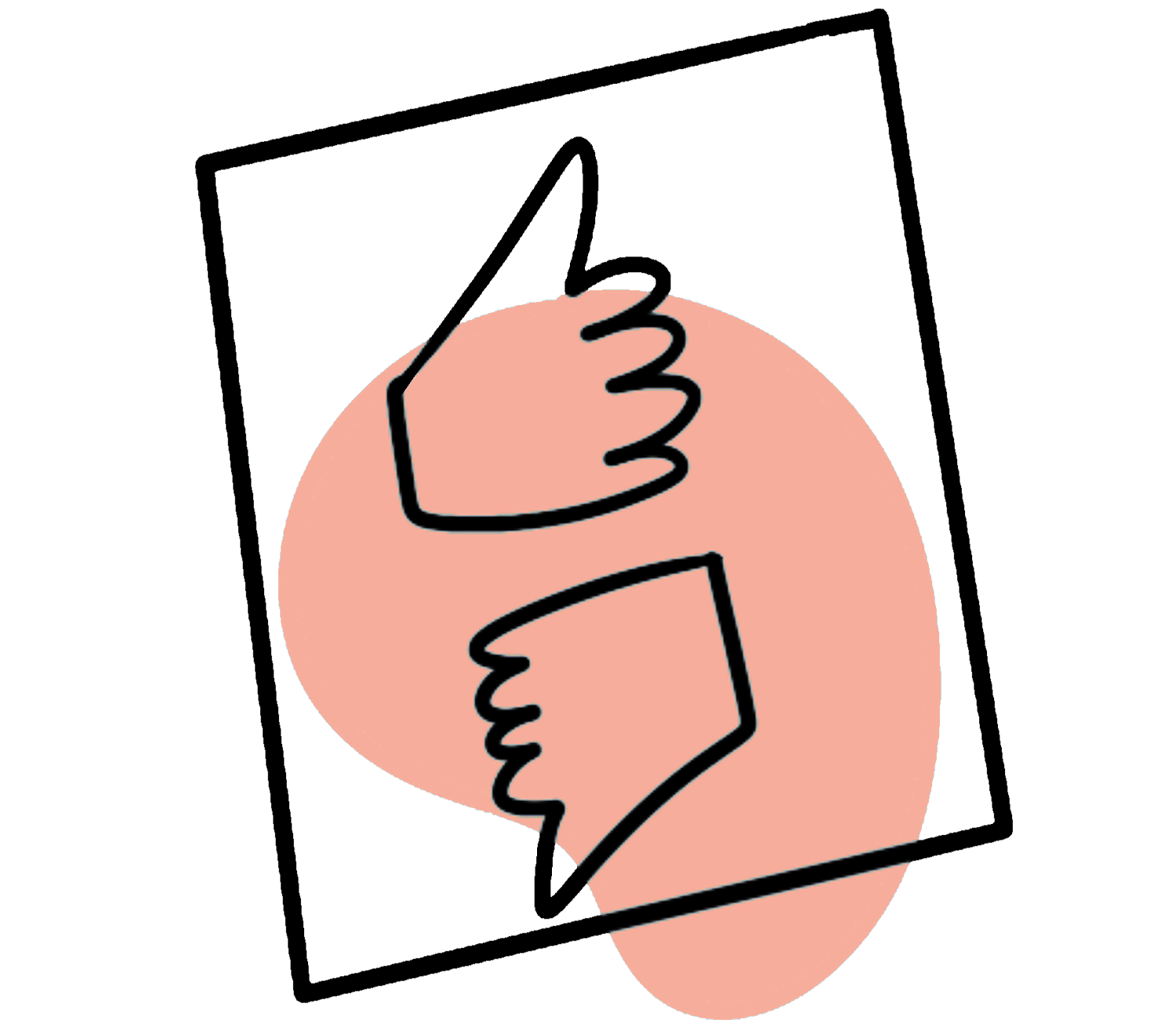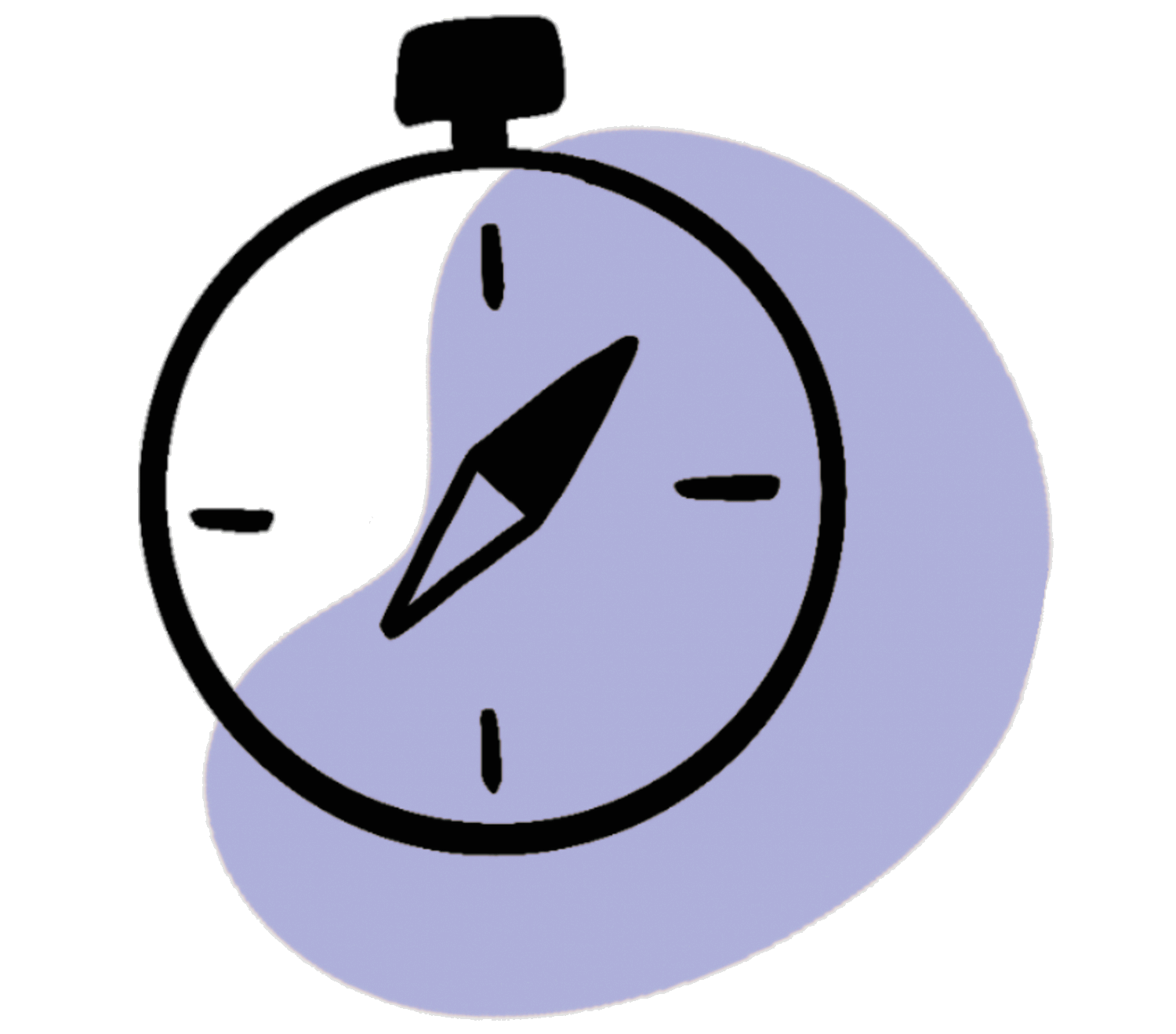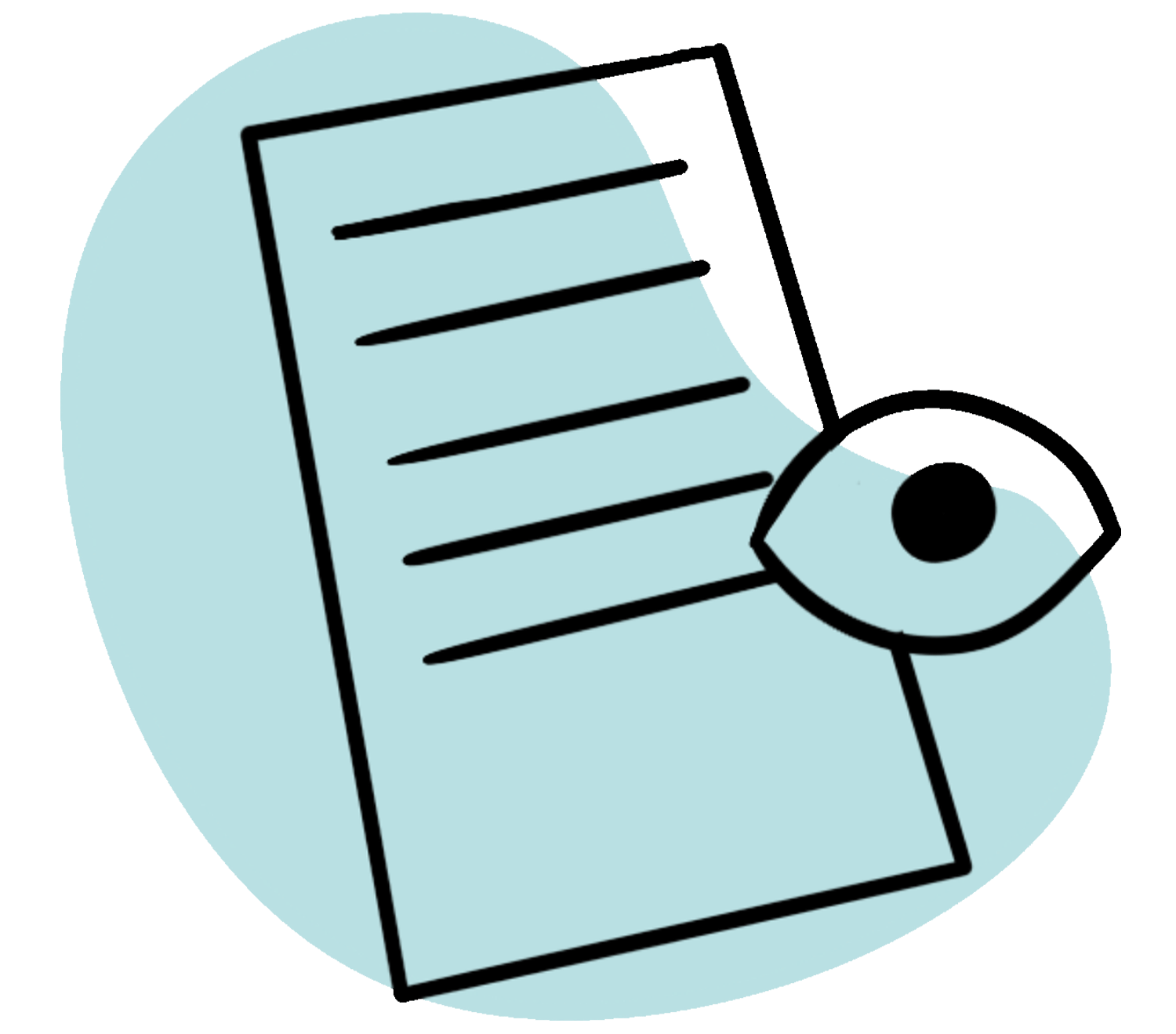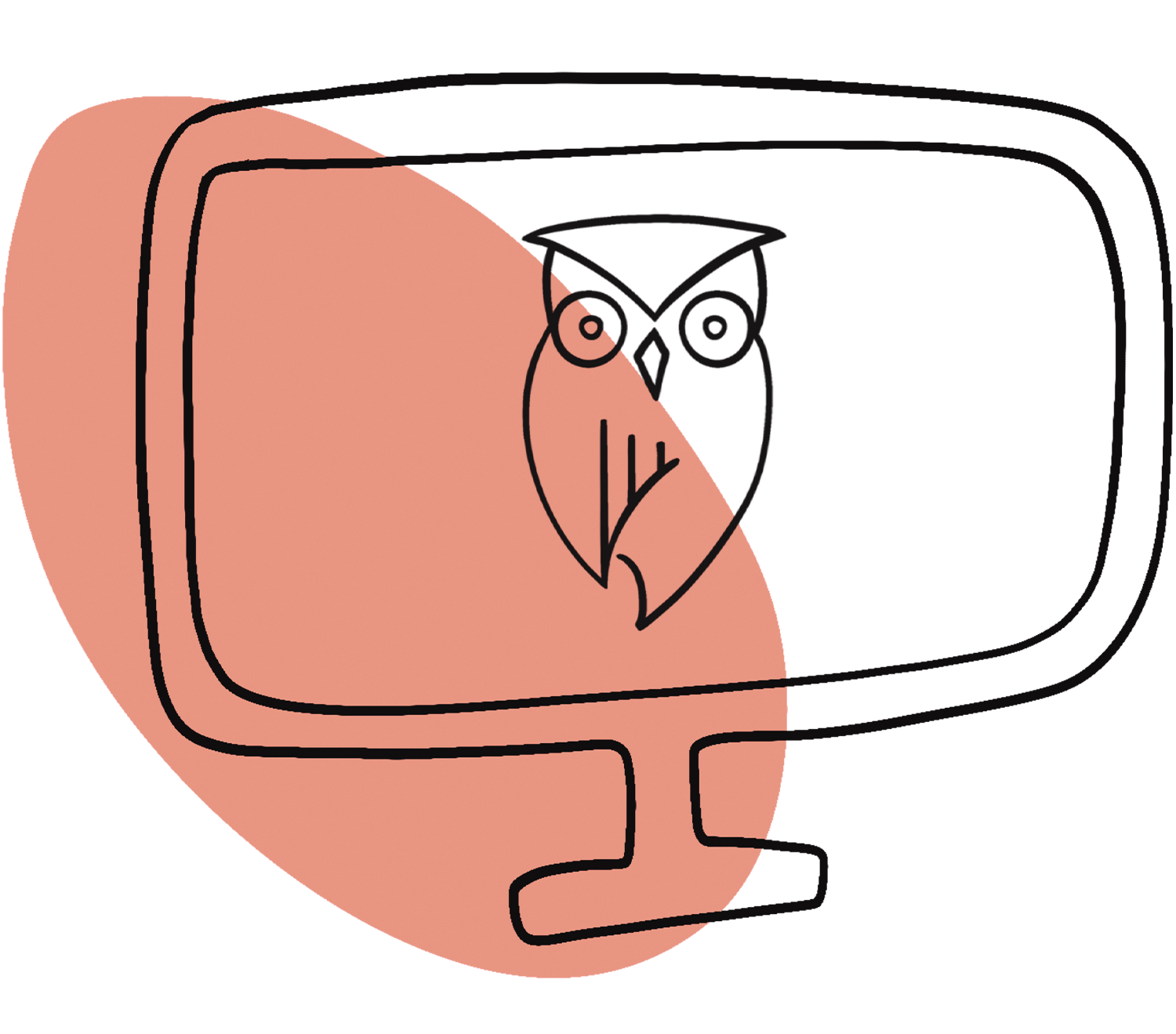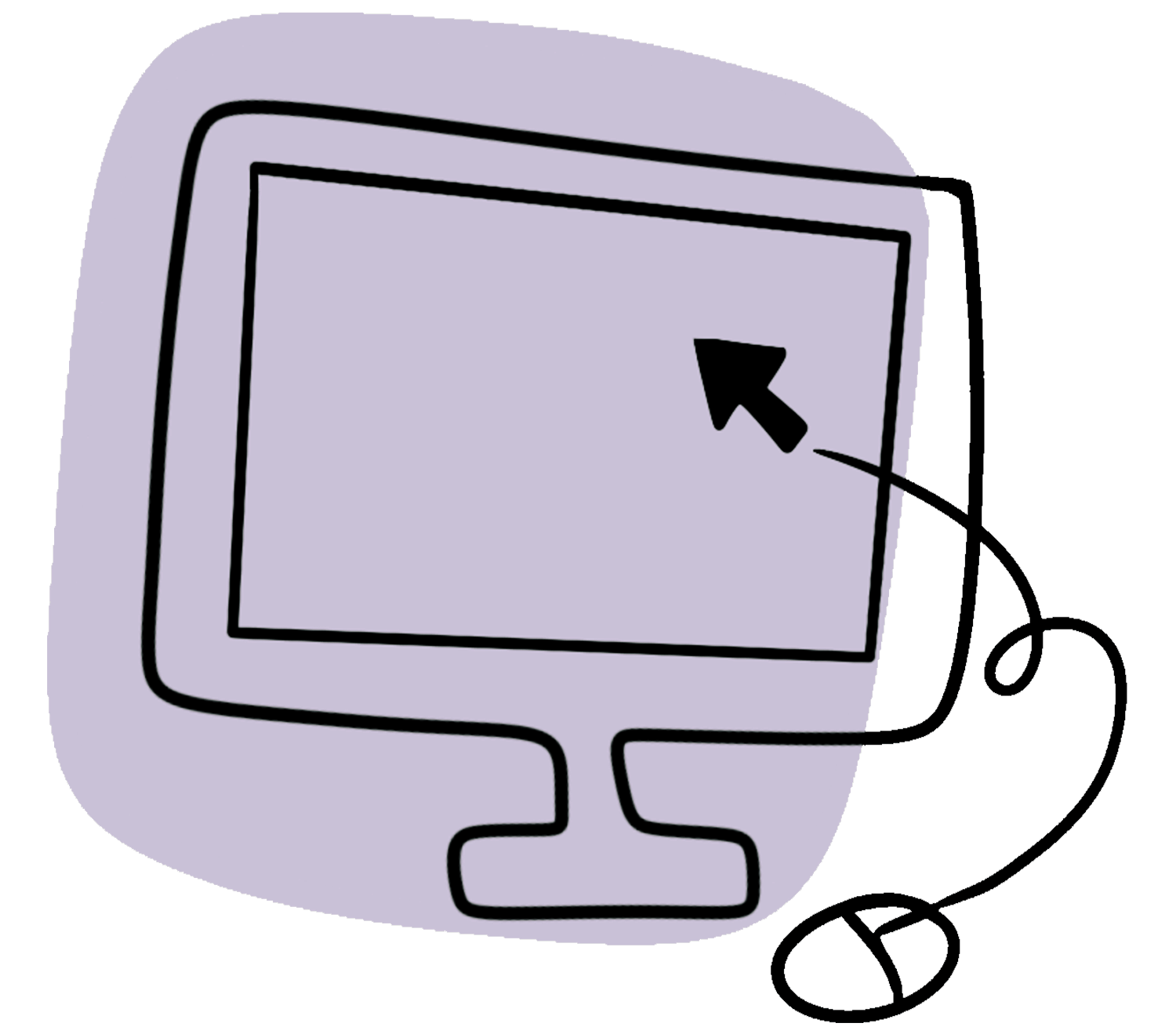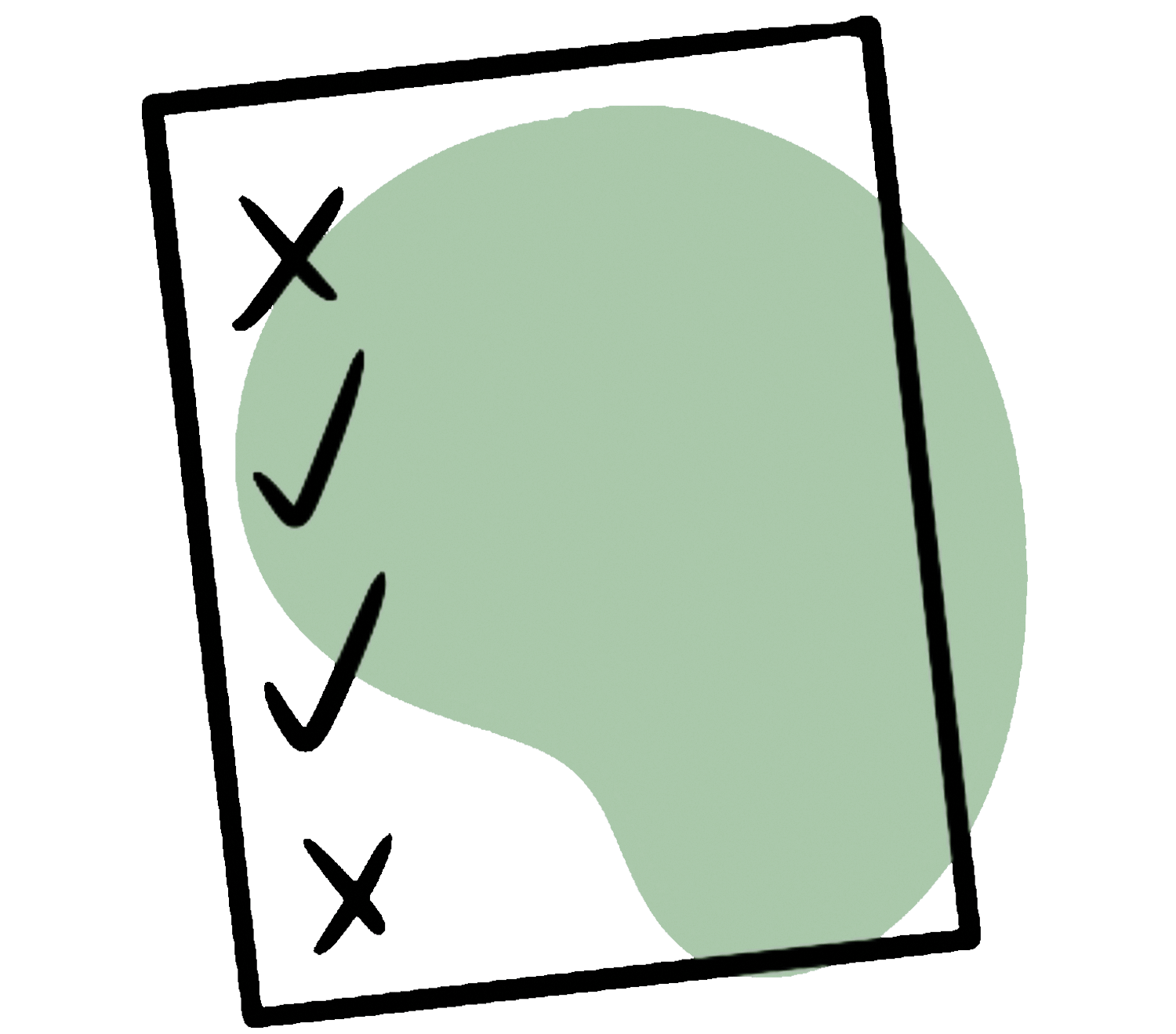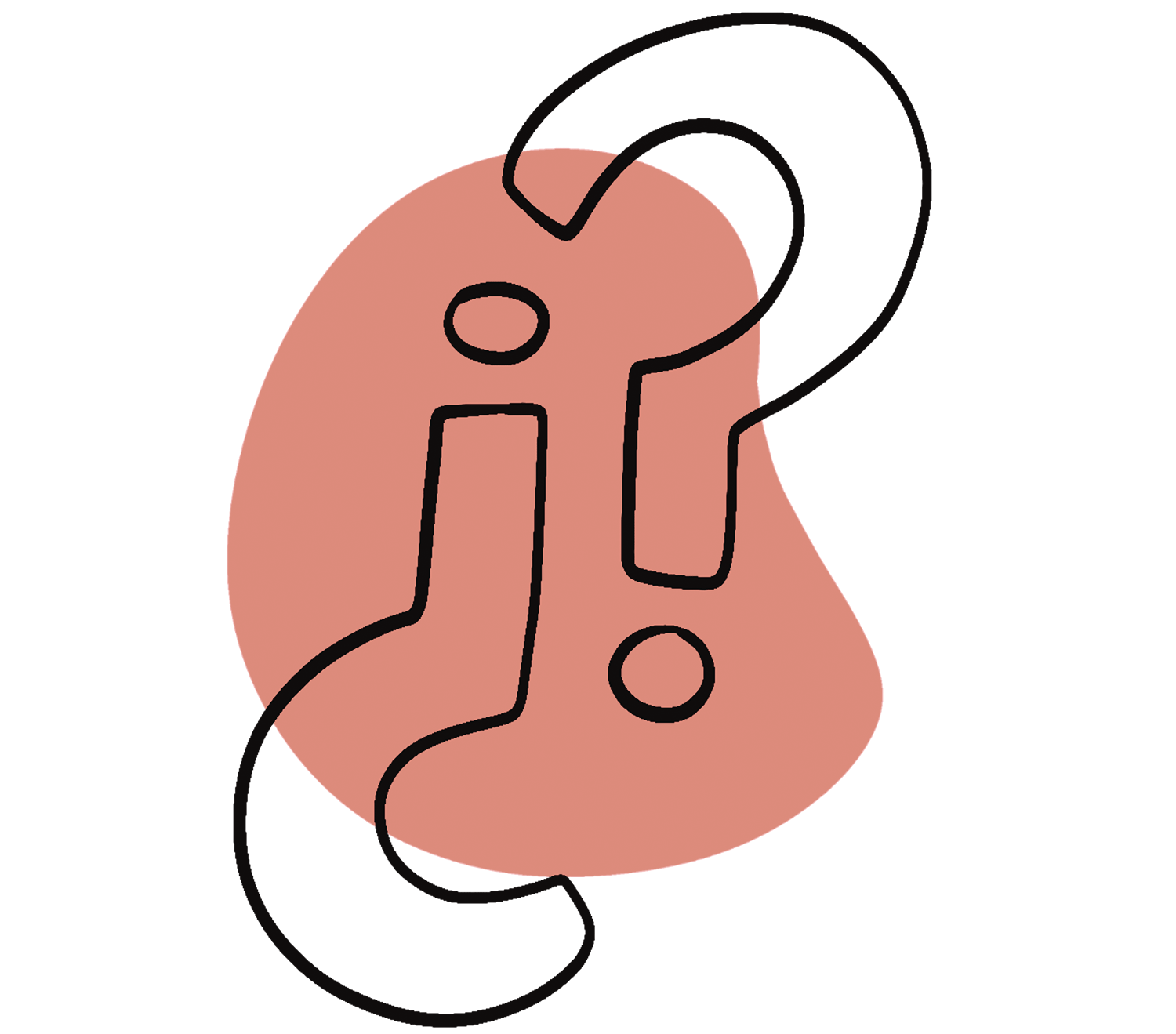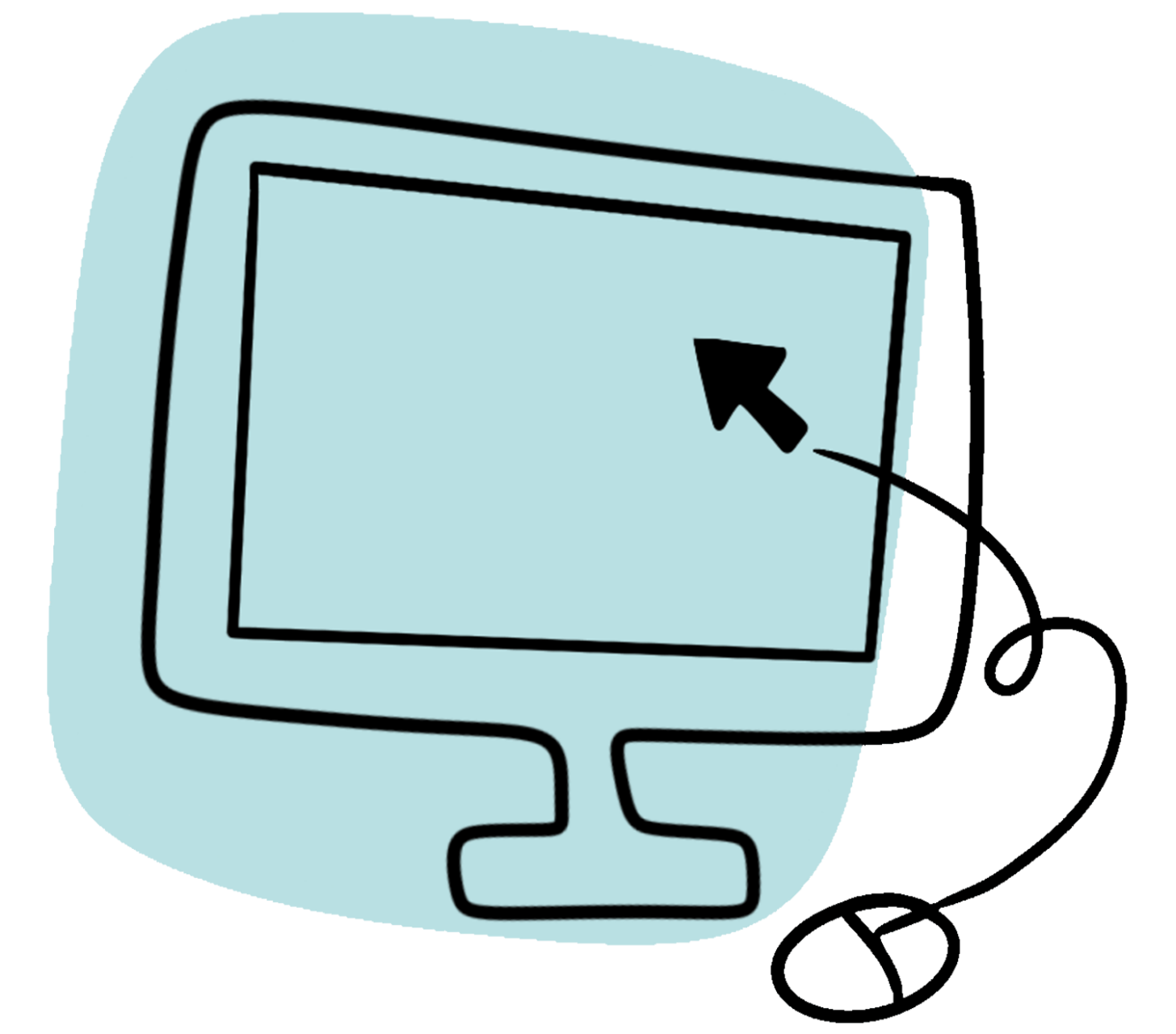
Am Ende der Arbeit findet sich das Literaturverzeichnis. Hier werden alle (und nur die) verwendeten Quellen aufgeführt. Nutzt du einen numerischen Zitierstil, werden die Quellen mit ihrer Nummer in der Reihenfolge ihres ersten Auftretens aufgelistet werden. Wird ein Autor-Jahr-Stil verwendet, werden die Quellen alphamerisch sortiert.
Im Folgenden werden die Angaben der verschiedenen Literaturtypen gemäß dem Zitationsstil IEEE Editorial Style Manual (German) aufgeführt, der für ingenieurwissenschaftliche Arbeiten häufig empfohlen wird. Den Zitierstil findest du in den Literaturverwaltungsprogrammen Zotero und BibTEX.
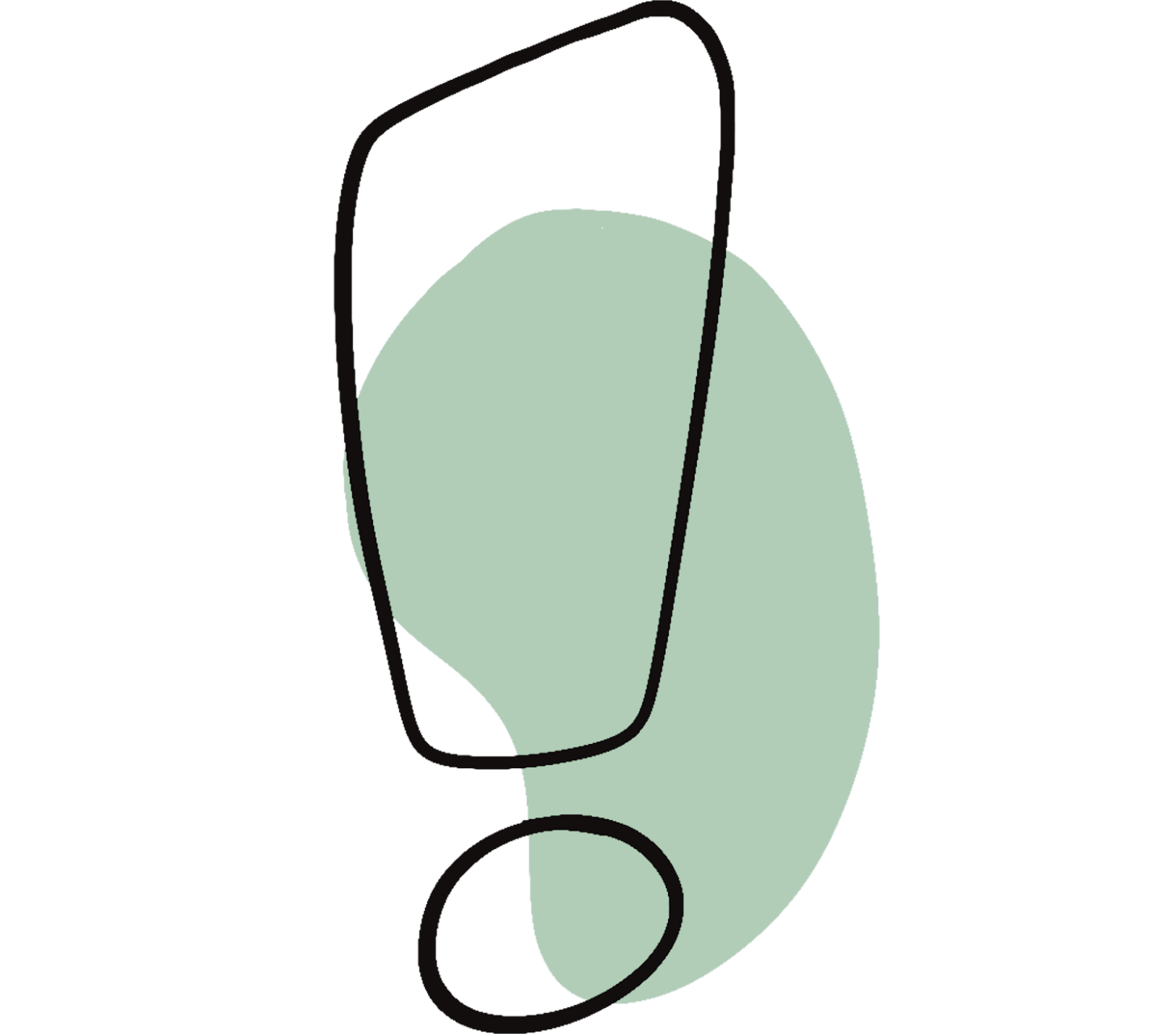
Als Monografie wird im akademischen Kontext ein Buch bezeichnet, das von einer oder mehreren Personen verfasst wurde, ohne dass bestimmte Teile einzelnen Autorinnen und Autoren zugeordnet werden können.
So wird’s gemacht: [Nr] Initiale des Vornamens. Nachname, Titel, Auflage, Verlagsort(e): Verlag, Jahr.
Beispiele:
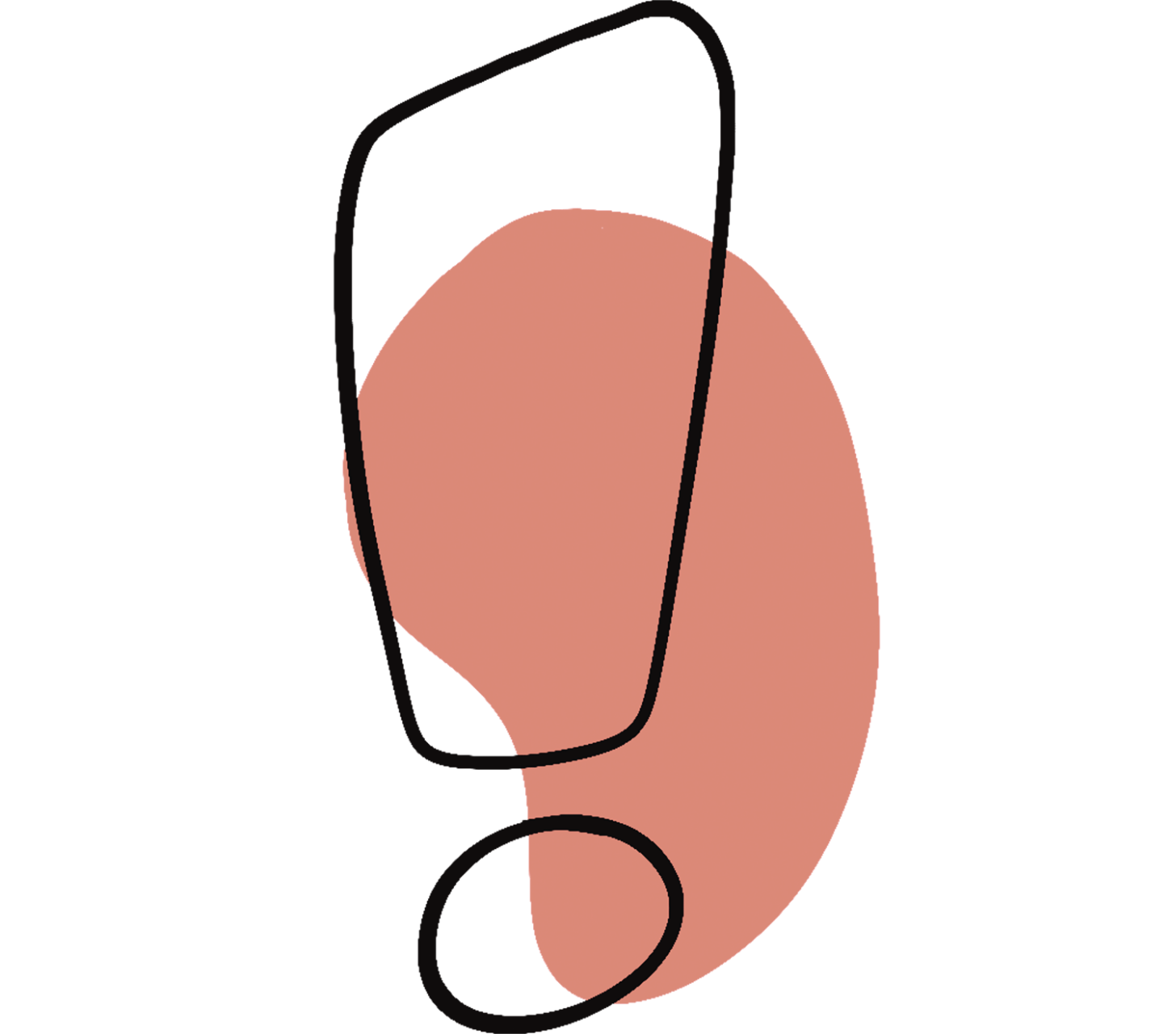
Sammelwerke sind Bücher, deren Kapitel (Beiträge) von verschiedenen Personen stammen. Das gilt meist auch für Lexika oder Handbücher. Bei Lexika und Handbüchern solltest du darauf achten, dass es sich um fachspezifische, nicht allgemeine Nachschlagewerke handelt.
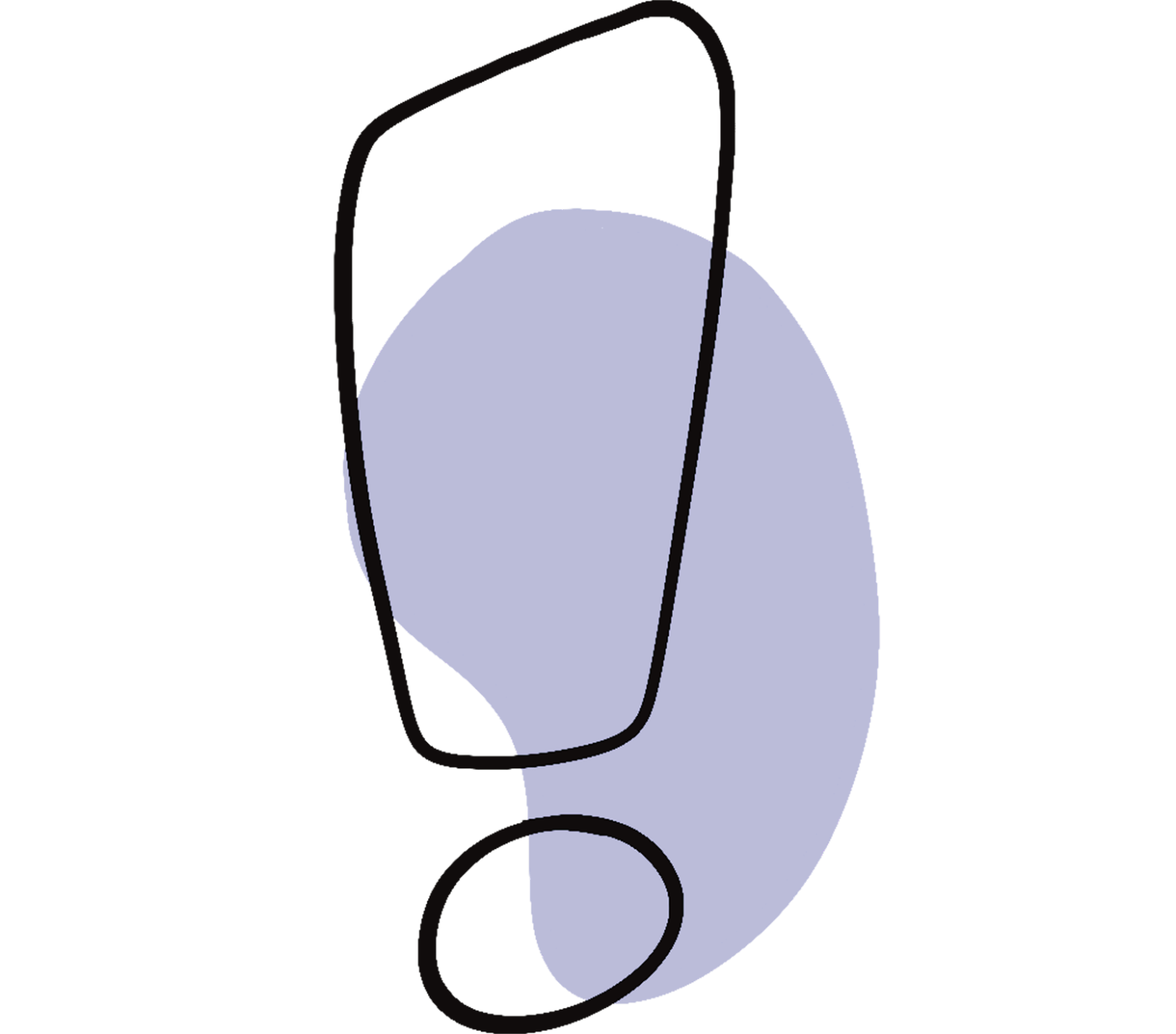
So wird’s gemacht: [Nr] Initiale(n) des Vornamens. Nachname (Autor/-in), „Titel des Beitrags“ in: Titel des Sammelwerks, Initiale des Vornamens. Nachname (Herausgebende), Hg., Auflage, Verlagsort(e): Verlag, Jahr, S. (Anfangsseite des Beitrags)–(Endseite des Beitrags).
Beispiel:
Internet-Dokumente sind unbeständig: Sie können gelöscht, geändert und verschoben werden. Deshalb muss immer das Datum genannt werden, an dem du die Quelle zuletzt begutachtet hast. Achte zudem auf zuverlässige, verbindliche Quellen.

Du kannst die URL dann zusätzlich angeben.
So wird’s gemacht: [Nr.] Initiale des Vornamens. Nachname, Titel des Internet-Dokuments, Jahr. [Online]. Verfügbar unter: URL (Zugriff am: Datum).
Beispiele:
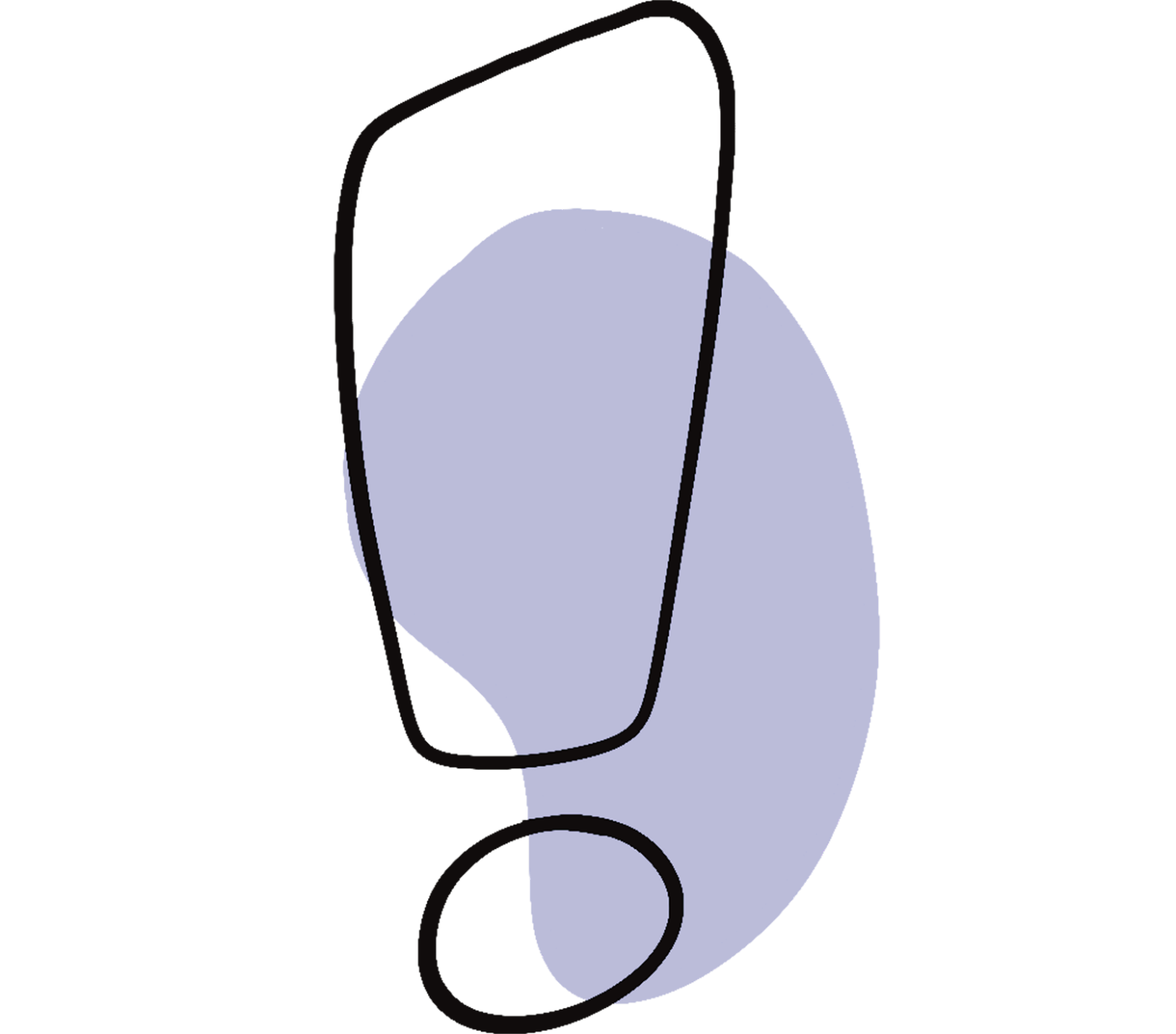
Da moderne Entwicklungen oft zuerst im Web veröffentlicht werden, kann es gerade im Open-Source- und Security-Bereich vorkommen, dass keine Bücher, Zeitschriften oder Proceedings (Tagungsbände) zu dem jeweiligen Thema existieren.
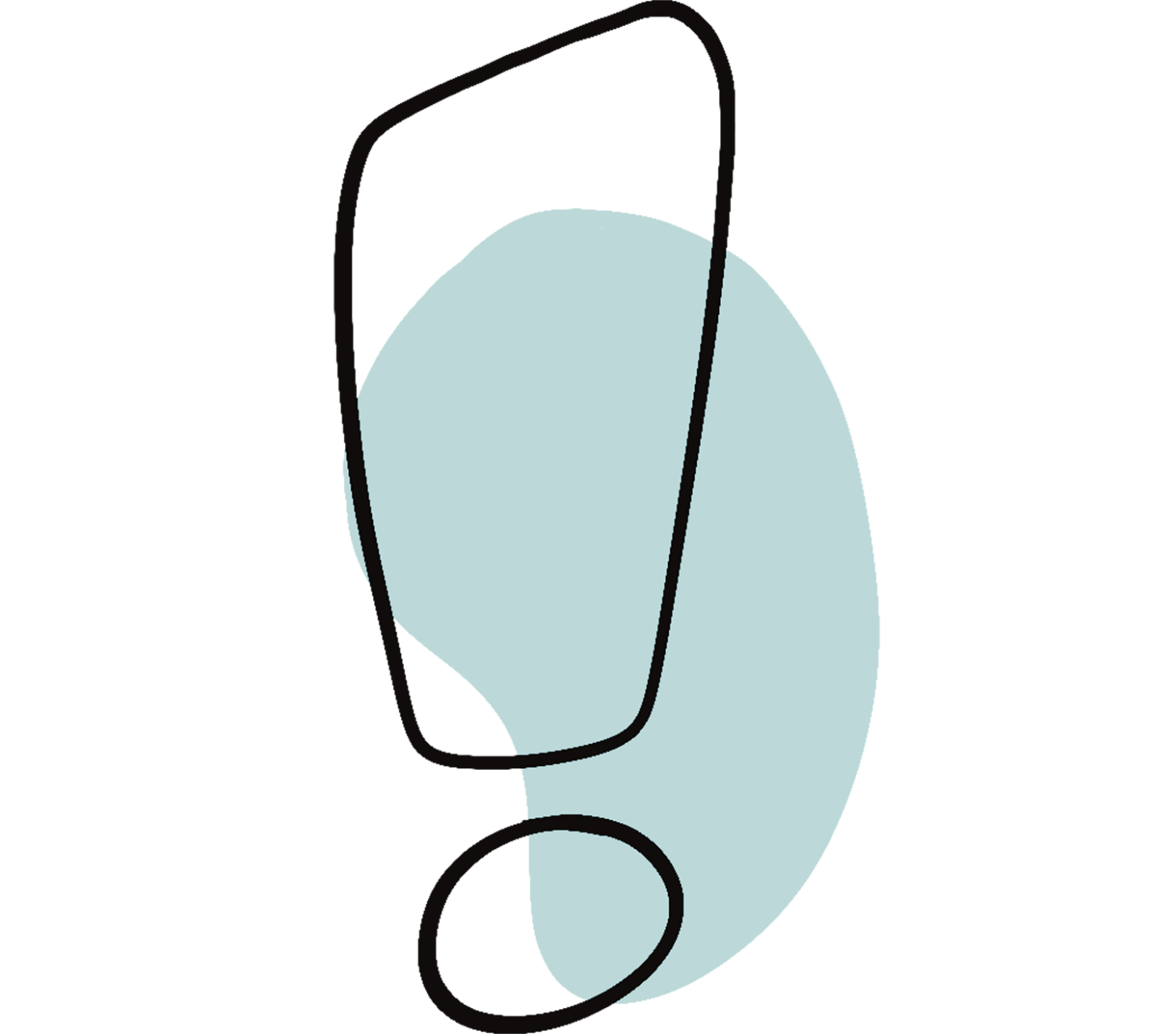
Blogs bekannter Expertinnen und Experten können hingegen zitierwürdig sein – in Ausnahmefällen auch Tutorials, wie z. B. bei besonders komplexen Themen.
Wikipedia ist innerhalb des Kollegiums umstritten. Aber du kannst Wikipedia als Startquelle verwenden, um dich einzulesen und weitere Referenzen zu finden.
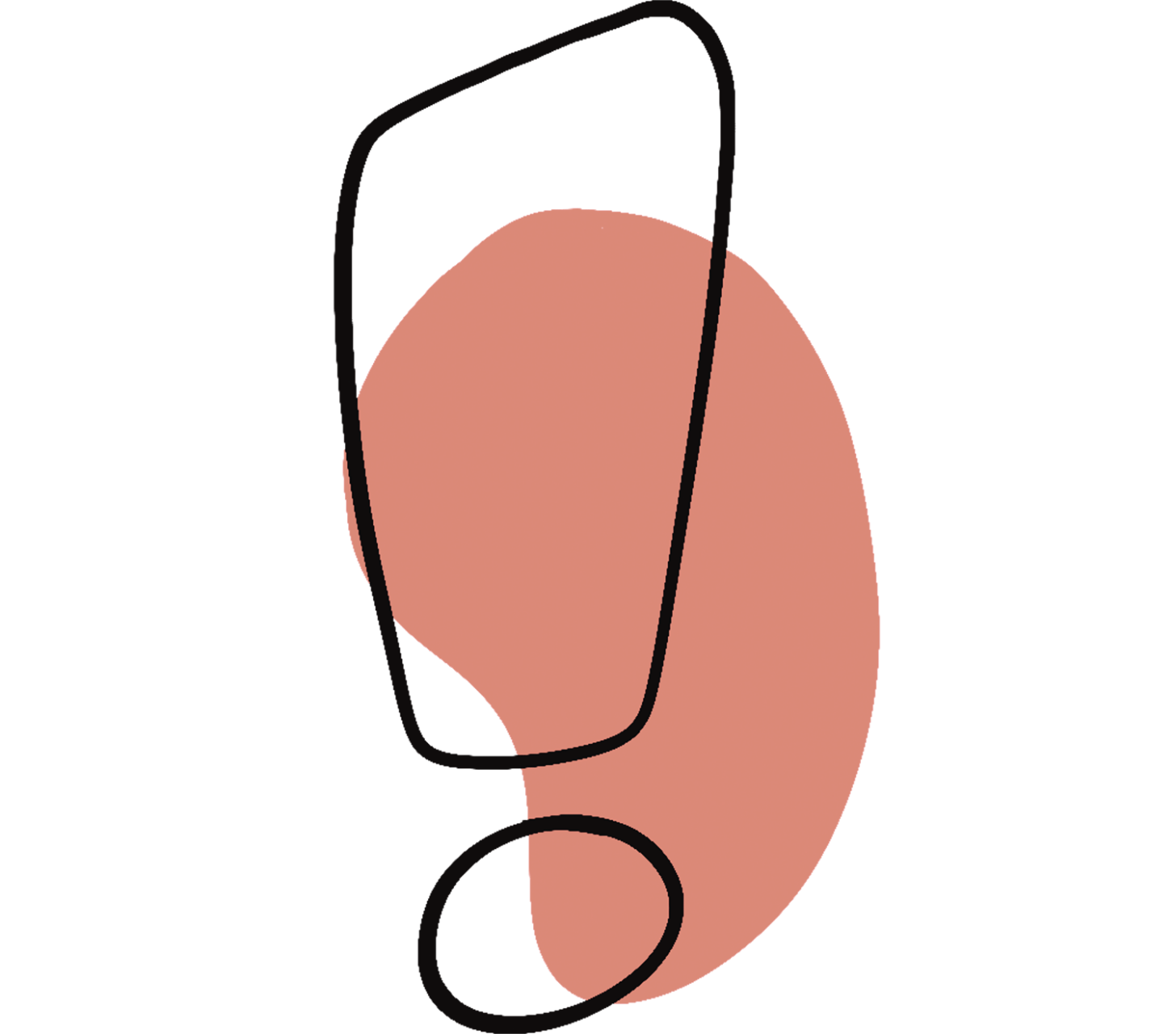
Verwende nur dann Wikipedia als Quelle, wenn das Online-Lexikon wirklich die beste Quelle ist. Normalerweise findest du dort jedoch immer Ursprungsquellen.
Wenn du Internetdokumente verwendest, speichere die Webseite mit „Speichern unter“ inklusive aller Grafiken und eingebetteter Materialien, und brenne diese mit auf den beizulegenden Datenträger. Im Literaturverzeichnis gibst du das Datum an, an dem du die Seite gespeichert hast.

Bei digital verfügbaren Büchern und Zeitschriften wird zunehmend ein Digital Object Identifier (DOI) angegeben.
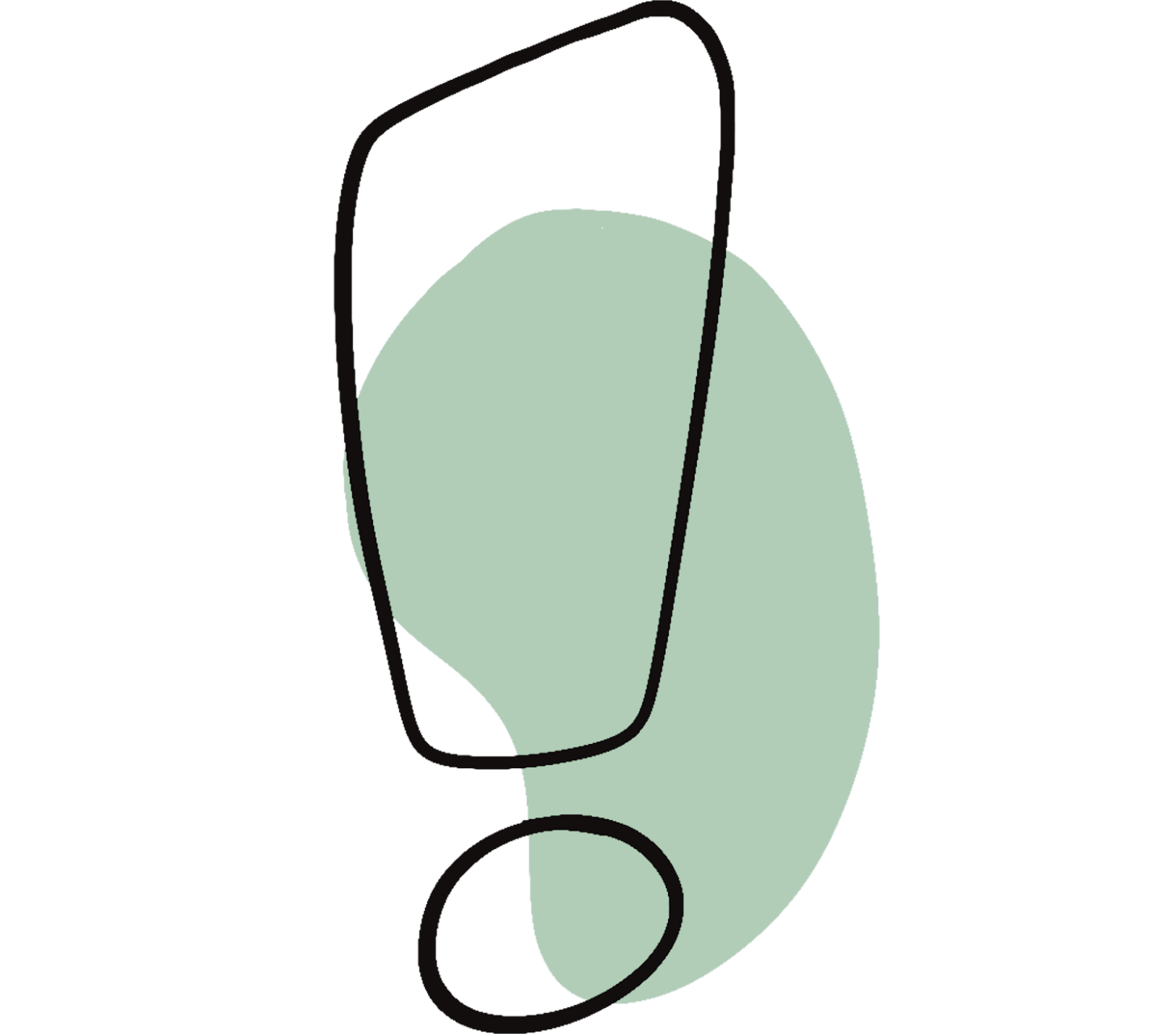
Die Kennung besteht aus einer Verlagskennung und einer Objektkennung, getrennt durch einen Schrägstrich. Hinter der URL http://dx.doi.org steht eine internationale Datenbank, die zu einem DOI die zugehörige URL ermittelt, unter der das Werk per HTTP abrufbar ist.
Der Vorteil dieser indirekten Indizierung ist, dass der DOI stets konstant bleibt. Bei Änderungen der Objekt-URL muss der Verlag nur die Referenzadresse in der Datenbank anpassen (z. B. bei Verlagswechsel, oder Änderung der Serverarchitektur).
Beispiel:
Bei Zeitschriften wird das einzelne Heft üblicherweise mit einer Nummer gekennzeichnet. Mehrere Hefte (typischerweise drei bis acht) werden zu einem Band zusammengefasst (oder auch Jahrgang oder engl. Volume).
Da in einem Band die Seitennummerierung einfach weiterläuft, heißt das, dass in einem einzelnen Heft des Bands die erste Seite in der Regel nicht mit Eins beginnt, sondern die Zählung vom letzten Heft fortgesetzt wird (außer es beginnt ein neuer Band).
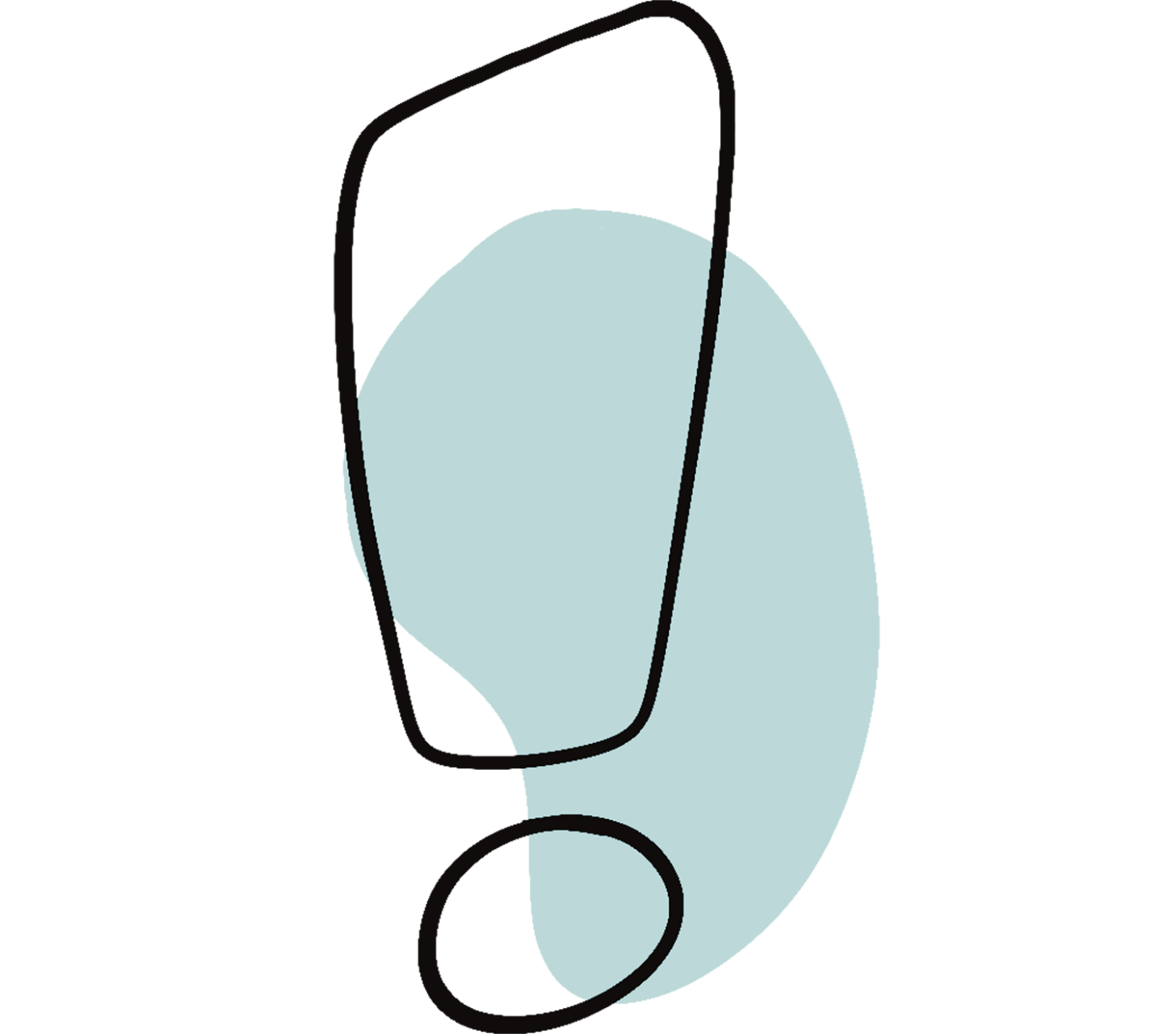
So wird’s gemacht: [Nr.] Initiale des Vornamens. Nachname, „Titel des Aufsatzes“, Titel der Zeitschrift, Jahrgang, Heftnummer, S. [Anfangsseite des Aufsatzes]–[Endseite des Aufsatzes], Jahr.
Beispiel:
Auch DIN-Normen, VDI-Richtlinien und VDE-Vorschriften müssen zitiert werden.
So wird’s gemacht: [Nr.] Titel der Norm – Untertitel, Nummer, Datum.
Beispiel:
So wird’s gemacht: [Nr.] Autor/-in, „Titel des Patents“, Patent-Nummer, Datum.
Beispiel:
Übrigens: Umfangreiche Informationen zu Schutzrechten kannst du im Anhang beifügen.
Unter Hochschulschriften fallen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen.
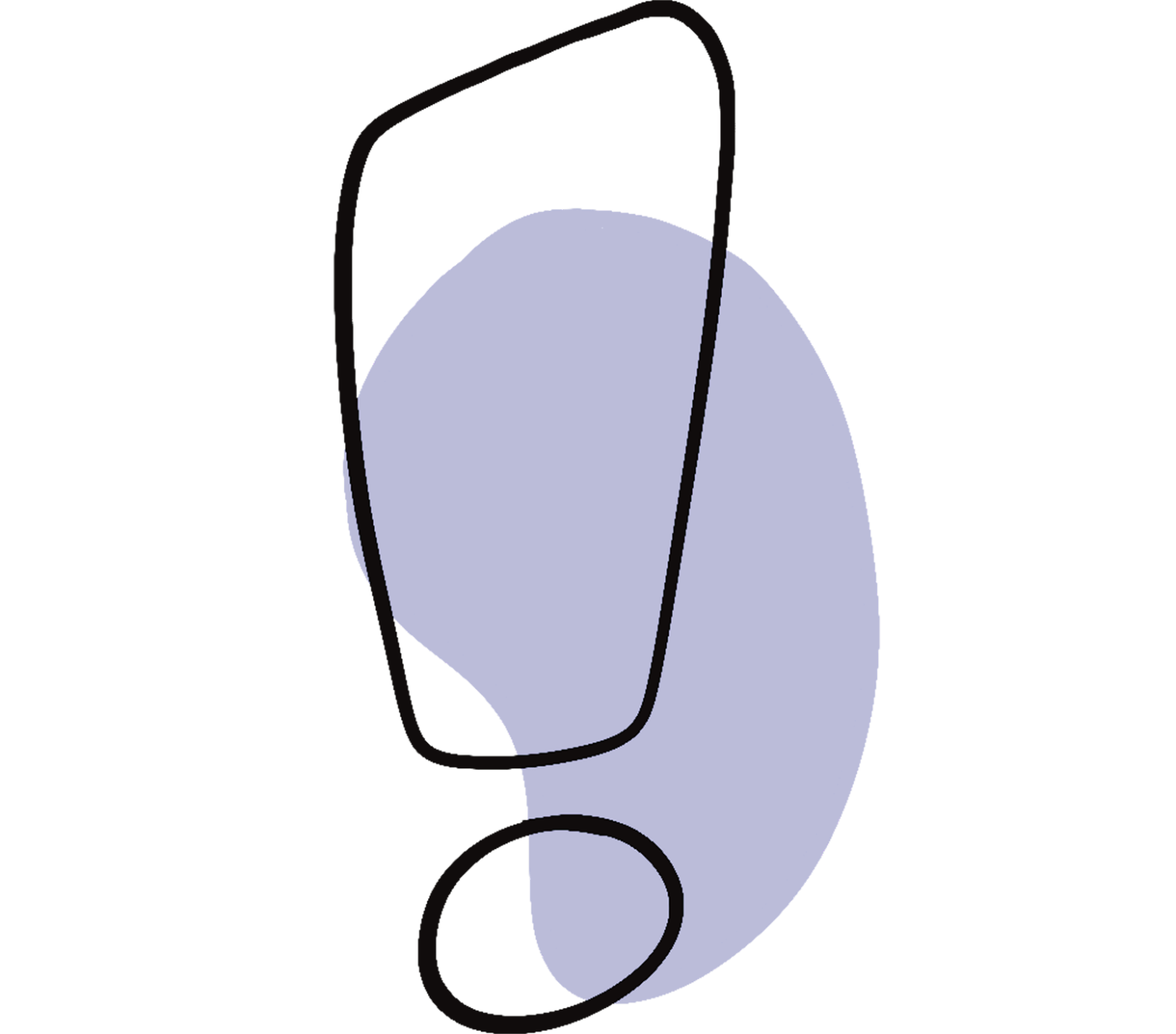
Andere Hochschulschriften zu zitieren, kann im Einzelfall passend sein: Falls du eine unveröffentlichte Bachelorarbeit oder Masterarbeit zitieren möchtest, dann solltest du das mit deinen Lehrenden absprechen. Es ist dann zulässig, wenn in der zitierten Arbeit relevante Forschungsergebnisse erarbeitet wurden.
So wird’s gemacht: [Nr.] Initiale des Vornamens. Nachname, „Titel“, Art der Hochschulschrift, Hochschule, Jahr.
Beispiel:
Bilder lassen sich auf zwei verschiedene Weisen zitieren:
- Wenn du eine Abbildung unverändert übernimmst, entspricht es einem direkten Zitat. Kennzeichne es so: „aus [21]“.
- Wenn du die Abbildung verändert übernimmst, entspricht dies einem indirekten Zitat. Kennzeichne diese Veränderung so: „nach [21]“.
Mündliche Informationen, die du z. B. von Kolleginnen und Kollegen erhältst, werden in einer Fußnote wie folgt zitiert: „1Persönliche Mitteilung von Frau G. Musterkollegin“. Bei einer Mehrfachnennung kann diese Quelle auch im Literaturverzeichnis aufgeführt werden. Es ist jedoch nur in seltenen Fällen eine valide Quelle.
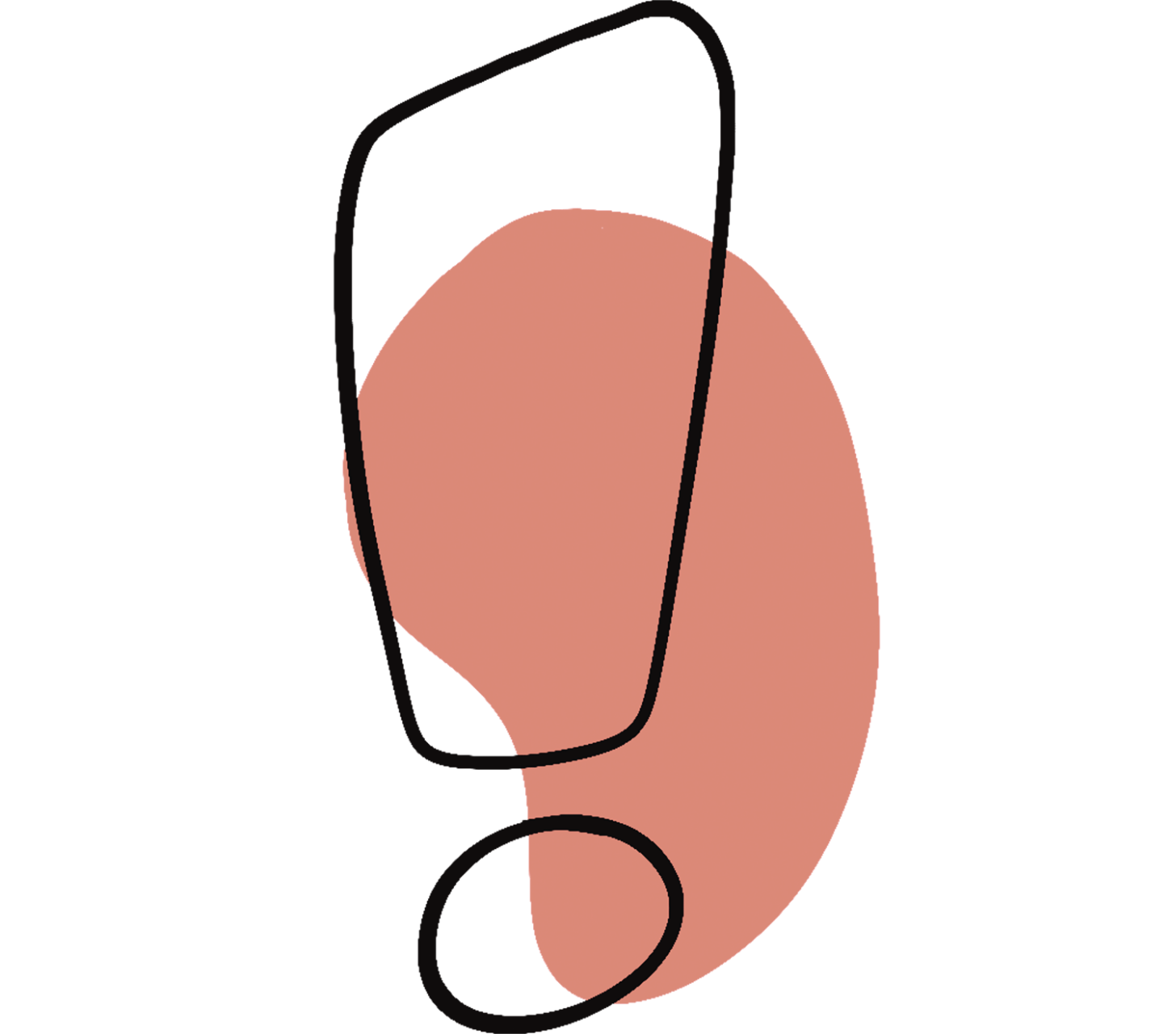
Auch bei Werken mit zwei oder mehr Autorinnen und Autoren werden im Literaturverzeichnis nach IEEE alle Beteiligten angegeben.
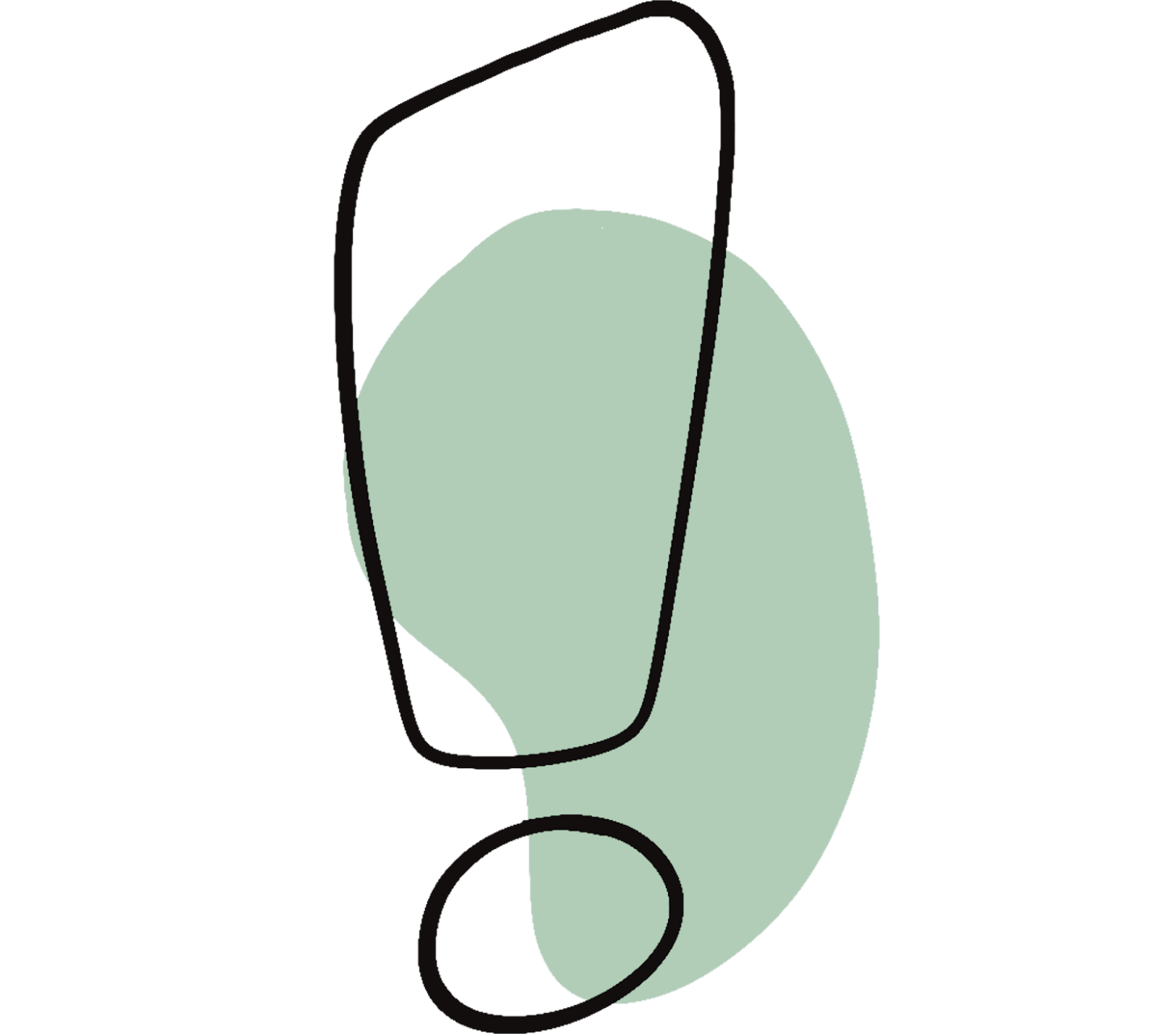
- Erstelle das Literaturverzeichnis automatisiert mit Hilfe eines Literaturverwaltungsprogramms wie Citavi oder BibTEX (bei LATEX).
- Achte darauf, dass alle Einträge im Literaturverzeichnis einheitlich und korrekt sind.
- Gib bei Beiträgen aus Sammelbänden immer sowohl den Titel des Beitrags mit den Verfassenden sowie den Titel des Gesamtwerkes mit den Herausgebenden an. Nenne die vollständigen Seitenangaben des Beitrags. Nur so lässt sich nachvollziehen, welchen Beitrag oder Artikel du genau zitierst.
- Die Einträge im Literaturverzeichnis enden mit einem Punkt.
- Verlagsnamen werden ohne die Angabe der Rechtsform des Verlags (z.B. GmbH, OHG) oder das Wort „Verlag“ aufgeführt. Ausnahme: Wenn der Begriff „Verlag“ Teil des Verlagsnamens ist, wie z. B. beim Fachbuchverlag Leipzig.
- Übernimm die Reihenfolge der Autorinnen und Autoren einer Quelle wie angegeben. Die Reihenfolge wurde bewusst gewählt.
- Akademische Titel (wie Dr. oder Prof.) werden im Literaturverzeichnis nicht mit aufgenommen.
- Vorlesungs-Skripte gelten meist nicht als wissenschaftliche Veröffentlichungen, da sie nicht allgemein zugänglich sind, und sind somit nicht zitierfähig.
Und nun bist du dran! Finde in folgendem Literaturverzeichnis 10 Fehler, die wir darin versteckt haben. Klicke auf die Stellen, an denen du einen Fehler vermutest. Ein grüner Haken zeigt an, dass du richtig liegst. Ein rotes Kreuz heißt, dass hier kein Fehler eingebaut wurde.
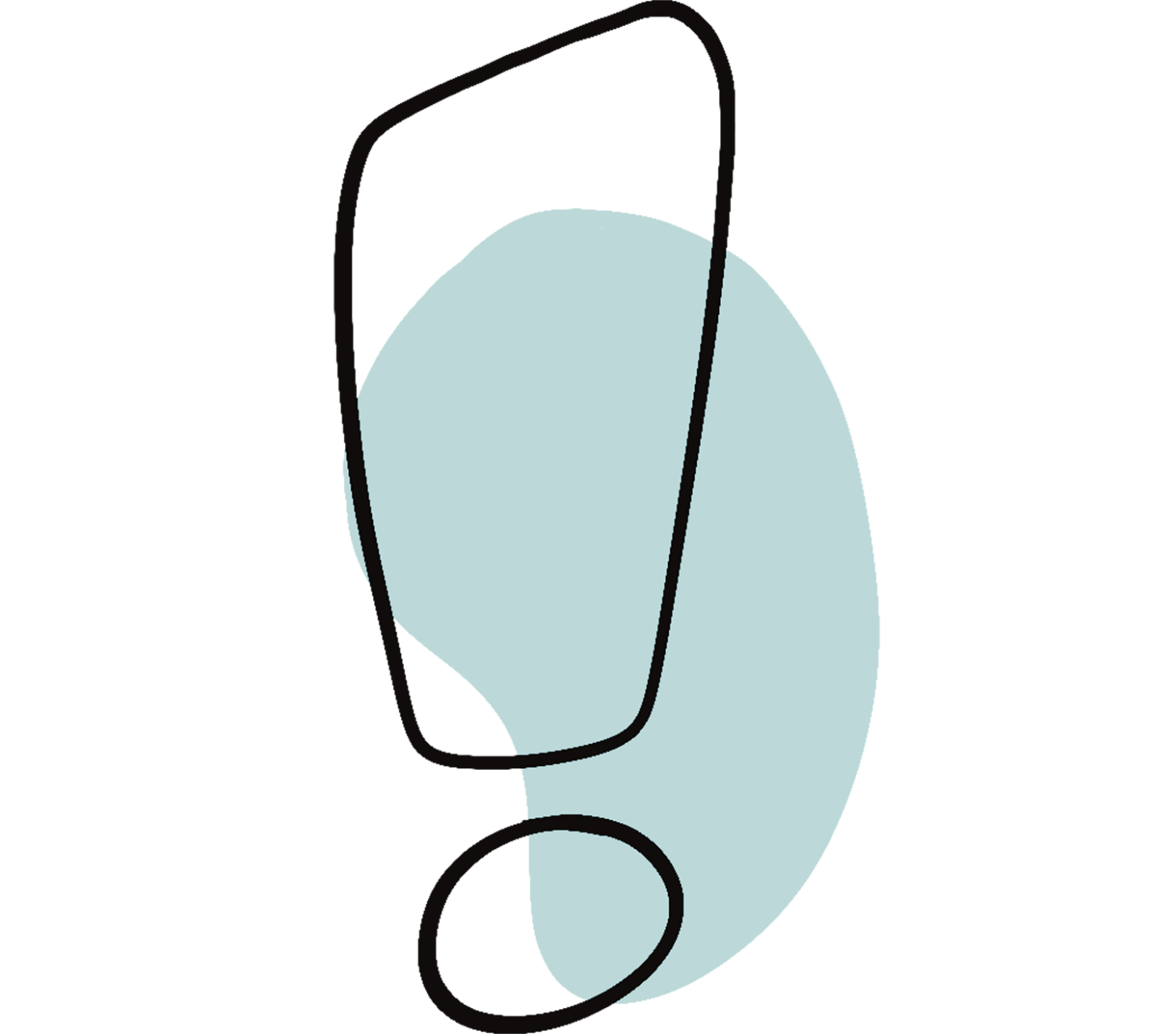
Kann ich YouTube-Videos zitieren?
Videos, z. B. von YouTube, sind in der Regel nicht zitierfähig, da sie meist nicht zur Sicherung heruntergeladen werden können bzw. dieses nicht erlaubt ist.
Was muss ich bei Internet-Dokumenten beachten?
Internet-Dokumente sind unbeständig: Sie können gelöscht, geändert und verschoben werden. Deshalb muss immer das Datum genannt werden, an dem du die Quelle zuletzt begutachtet hast. Achte zudem auf zuverlässige, verbindliche Quellen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im Mai 2025 und zuletzt aktualisiert im Mai 2025.