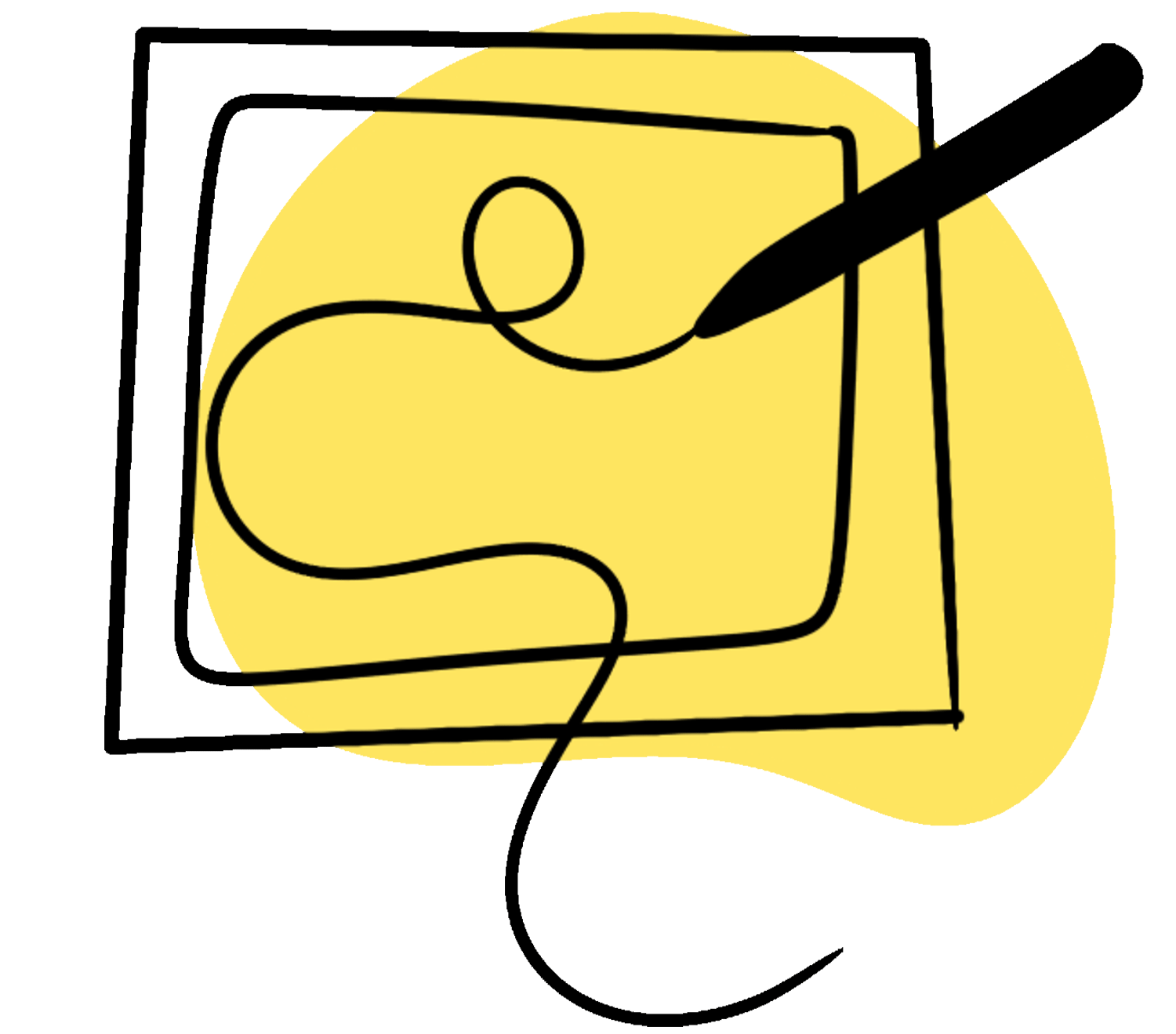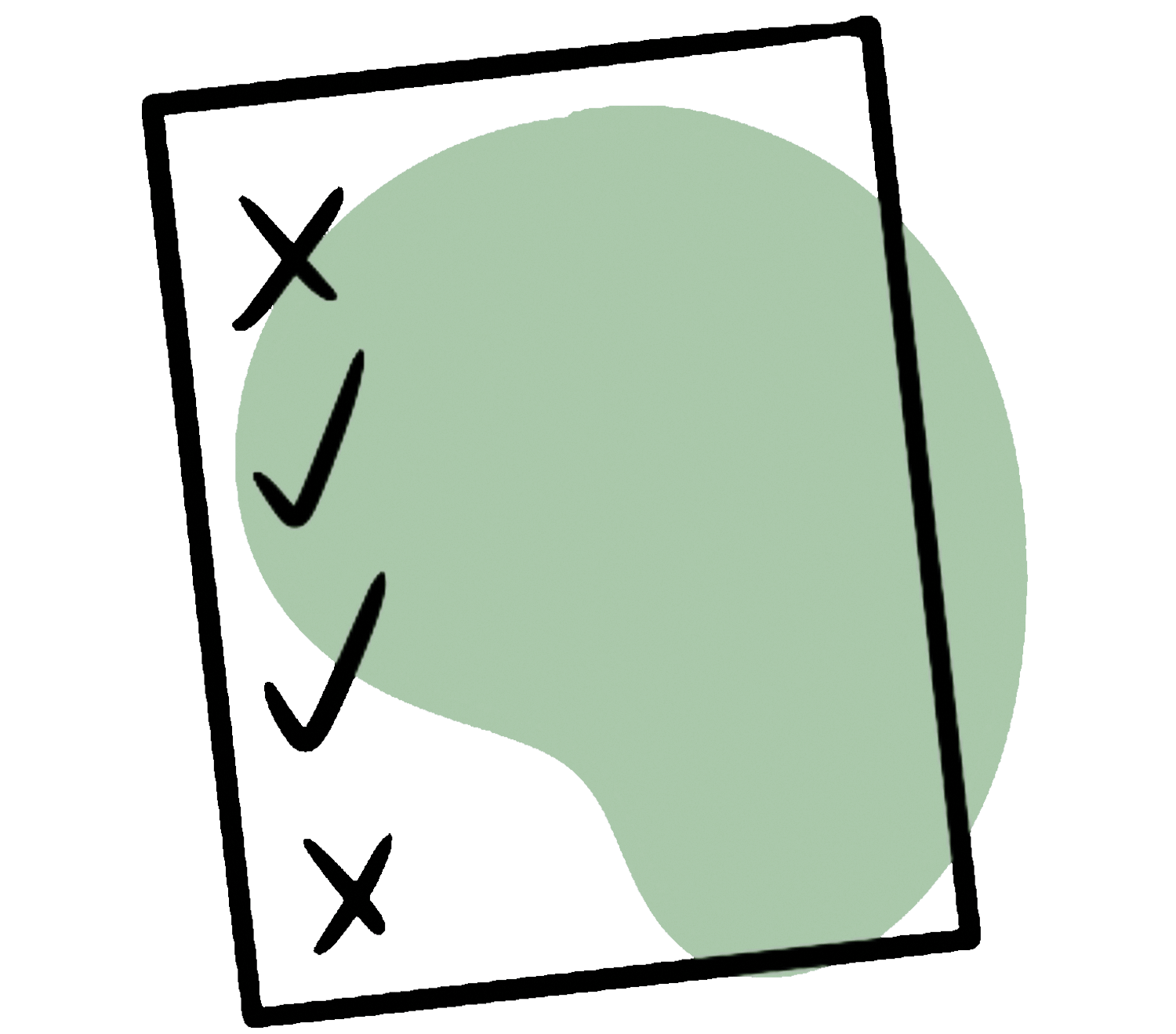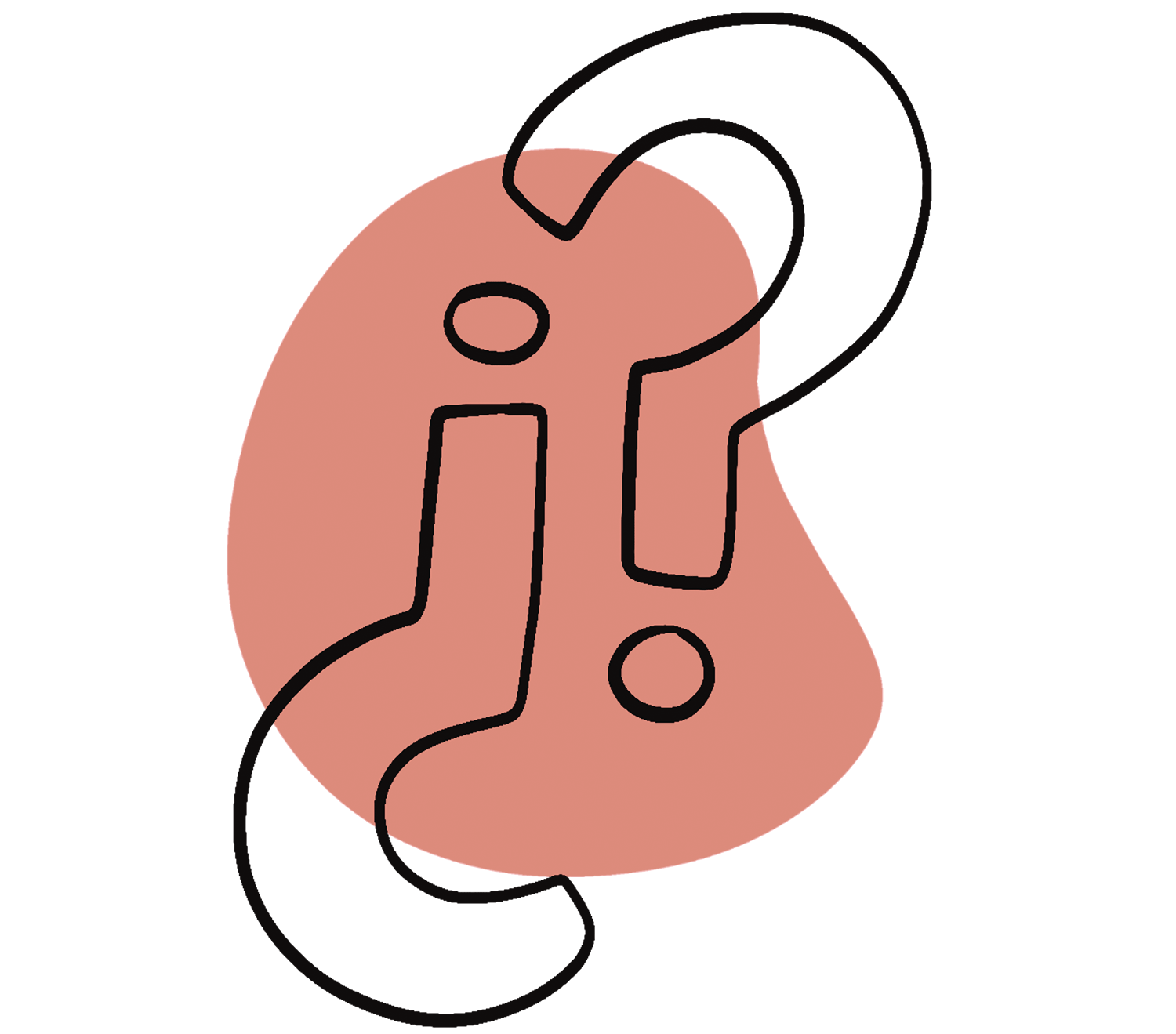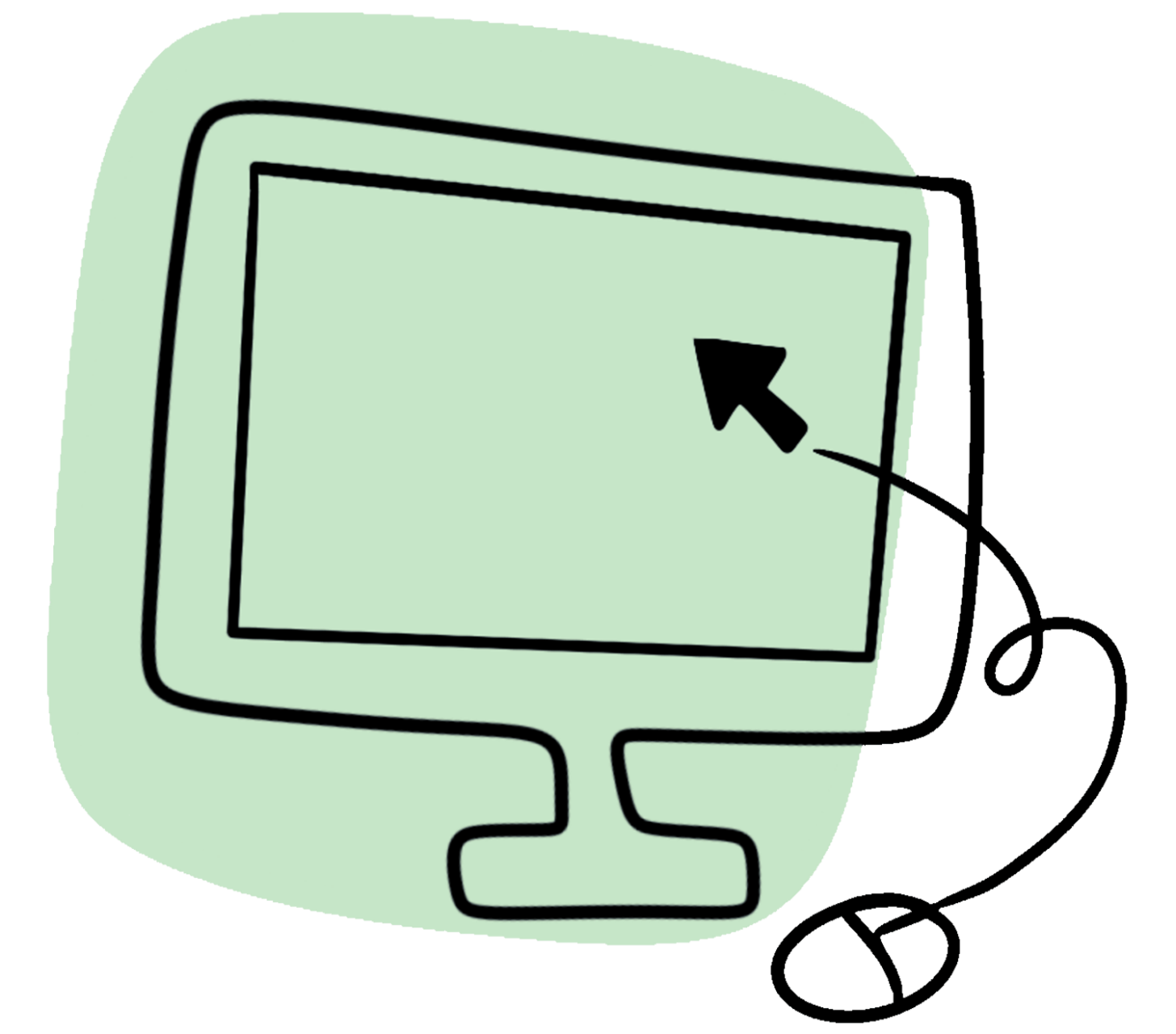
Eine Einleitung sollte vor allem drei Fragen beantworten:
- Welches Thema behandelt die Arbeit?
- Welche Fragen werden zu diesem Thema beantwortet?
- Bei empirischen Arbeiten: Mit welcher Methode werden diese Fragen beantwortet?
Zuerst:
Skizziere den Kontext des Themas. Mit Bezug auf die Literatur zeigst du, welche Relevanz das Thema hat:
- Hier kannst du dich auch auf Erfahrungen aus der Praxis, auf die Tagespolitik oder auf aktuelle Ereignisse beziehen.
- Es geht dabei weniger um deine persönlichen Beweggründe für die Themenwahl, als darum, inwiefern es sich um ein fachliches Problem handelt – egal, ob für die Praxis, die Profession, oder das Themengebiet.
Manche Arbeiten, z. B. aus der rekonstruktiven Sozialforschung, nennen zudem den persönlichen Bezug zum Thema – Besprich mit deinen Betreuenden, ob dies sinnvoll für deine Arbeit ist.
Anschließend:
Stelle dein eigenes Vorgehen vor:
- Nenne hier unbedingt deine konkrete(n) Fragestellung(en).
- Erkläre, wie die vorliegende Arbeit die Frage(n) beantwortet.
- Stelle das Ziel der Arbeit dar.
- Erwähne die methodische Herangehensweise, z. B. ob du Interviews oder teilnehmende Beobachtungen durchgeführt hast.
Hilfreich für die Lesenden ist es oft, wenn du anschließend die Struktur der Arbeit mit dem Fokus der jeweiligen Kapitel vorstellst.
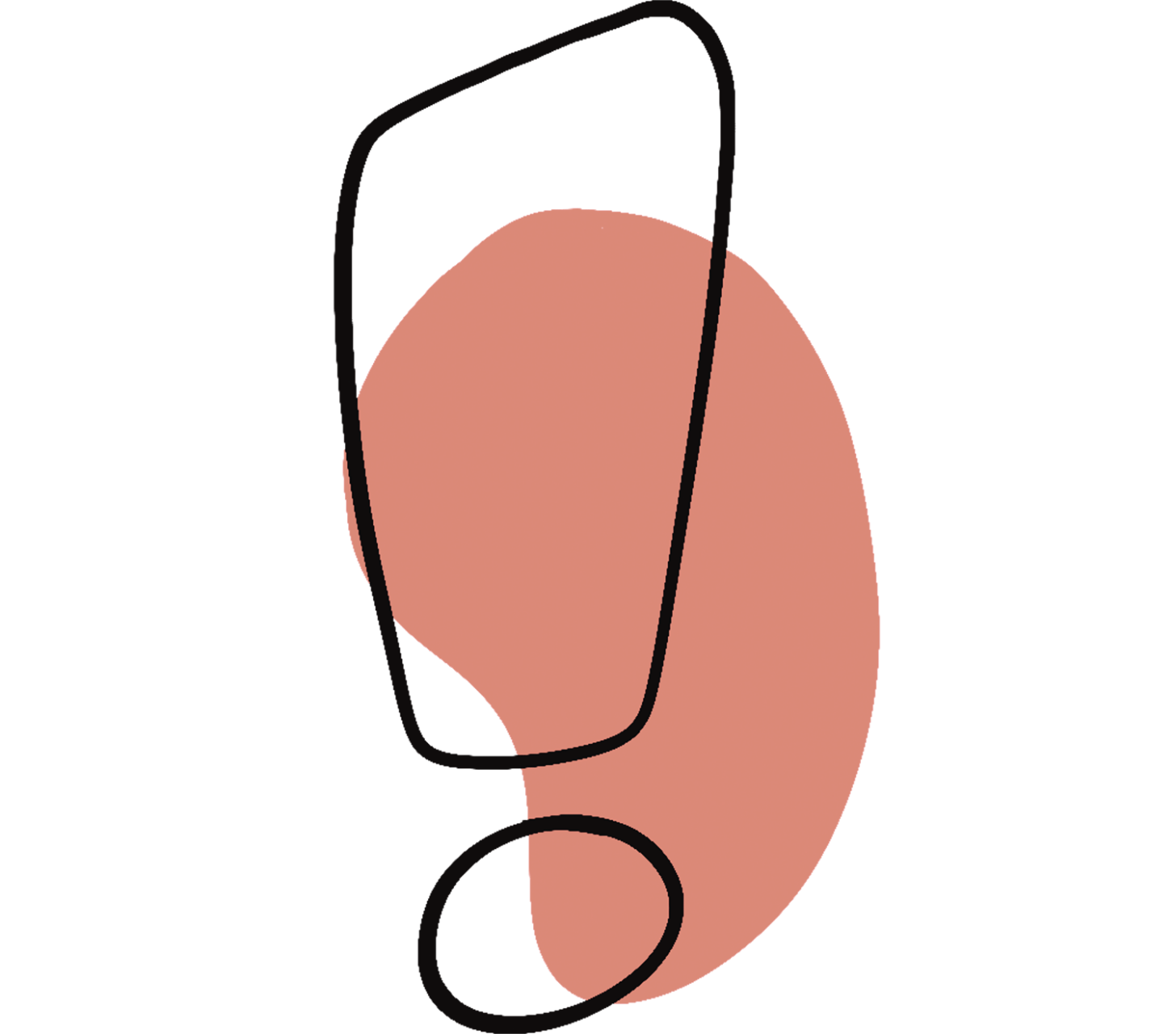
Folgende Fragen sollten in der Einleitung beantwortet werden:
- In welchem wissenschaftlichen, fachlichen, oder gesellschaftlichen Kontext steht das Thema?
- Welche Teilaspekte des Themas bearbeitest du, und warum?
- Welche Bedeutung hat die Bearbeitung des Themas für die Wissenschaft oder die Praxis?
- Falls für deine Arbeit relevant: Welcher aktuelle Anlass führt zur Bearbeitung des Themas?
- Welche Methode wurde gewählt, um die Frage zu beantworten?
- Wie ist die Arbeit aufgebaut? Wie und nach welchen Kriterien sind die Kapitel geordnet?
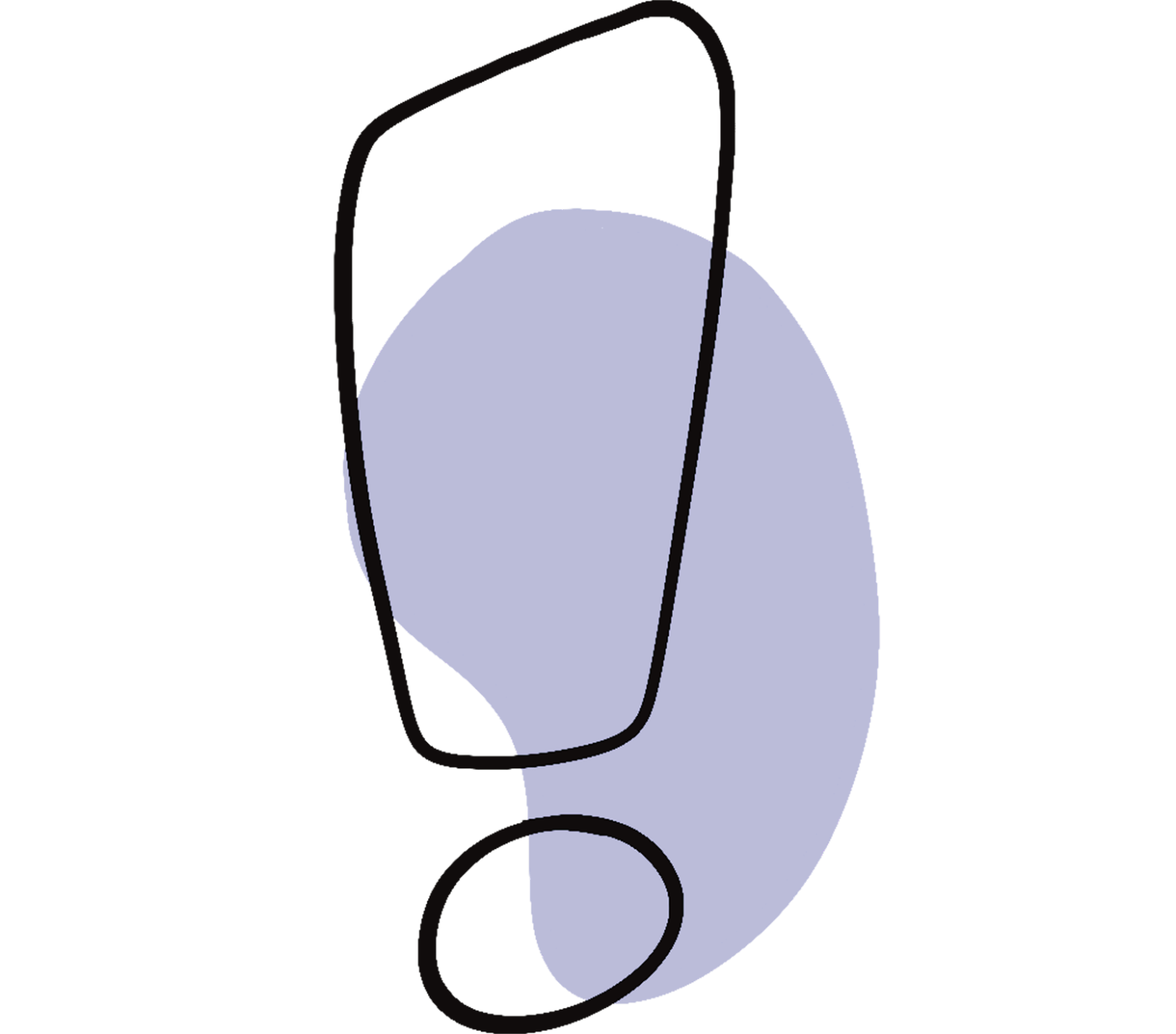
Vermeide diese typischen Fehler in deiner Einleitung:
- Die Zielsetzung wird in der Einleitung nicht genannt.
- Die Einleitung macht den Eindruck, dass das Thema zu groß ist, weil nicht deutlich gemacht wird, dass hier nur ein Teilaspekt behandelt wird.
- Die Einleitung besteht aus zu vielen Elementen, die nicht zusammen passen.
- Die Einleitung enthält Elemente, die in den Hauptteil der Arbeit gehören. Die Einleitung sollte lediglich in die Inhalte einführen, die im Hauptteil ausgearbeitet werden.
- Der fachliche Kontext und die Relevanz der Fragestellung werden nicht sichtbar.
- Die Einleitung erklärt nur den weiteren Aufbau der Arbeit – diesen haben die Lesenden aber schon im Inhaltsverzeichnis gesehen.
- In der Einleitung fehlt die Motivation: Warum wurde diese Arbeit mit genau dieser Zielsetzung bearbeitet?
- Falls du deine Arbeit in Kooperation mit einer Einrichtung geschrieben hast: Die Einrichtung wird zu ausführlich vorgestellt, und die Vorstellung der Einrichtung liest sich wie ein Werbetext.
Ganztagsschulen als „Rundum-Sorglos-Paket“?
Bildung hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Umso schockierender waren 2001 die Ergebnisse der PISA-Studie: Die Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler wurden im Lesen, in der Mathematik und den Naturwissenschaften im internationalen Vergleich als unterdurchschnittlich bewertet (Baumert et al., 2001). Zudem zeigte sich, dass in keinem anderen der 43 teilnehmenden Staaten die Schulleistungen so eng an den sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie gekoppelt waren wie in Deutschland (ebd.). Nicht nur auf politischer Ebene wurden Forderungen nach einem leistungsfähigeren Schulsystem sowie nach Reformen im Bildungswesen laut.
Der verstärkte Ausbau von Ganztagsschulen in Deutschland kann als ein Resultat dieser Debatte gesehen werden. Die Bundesregierung beschloss 2003 das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) und stellte damit vier Milliarden Euro für den bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen in Deutschland zur Verfügung (Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], 2013). Ein Blick auf die von Bundesregierung und Experten angestrebten Ziele erweckt den Eindruck, das Konzept der Ganztagsschule stelle eine Art „Rundum-Sorglos-Paket“ dar, mit dem alle Probleme auf einen Schlag zu lösen seien. Angesichts der schwierigen Haushaltslagen der Kommunen, des Lehrkräftemangels, der Raumknappheit und des fehlenden pädagogischen Personals in vielen deutschen Schulen stellt sich allerdings die Frage, ob die Ganztagsschule tatsächlich halten kann, was sie verspricht. Mit dieser Frage setzt sich die vorliegende Arbeit kritisch auseinander. Es wird deutlich, dass trotz der teils hohen Anstrengungen der Beteiligten die Ansprüche an die Ganztagsschulen in der pädagogischen Praxis nicht immer umgesetzt werden können. Dies ist insbesondere den unterschiedlichen politischen und damit auch finanziellen Rahmenbedingungen der Bundesländer geschuldet.
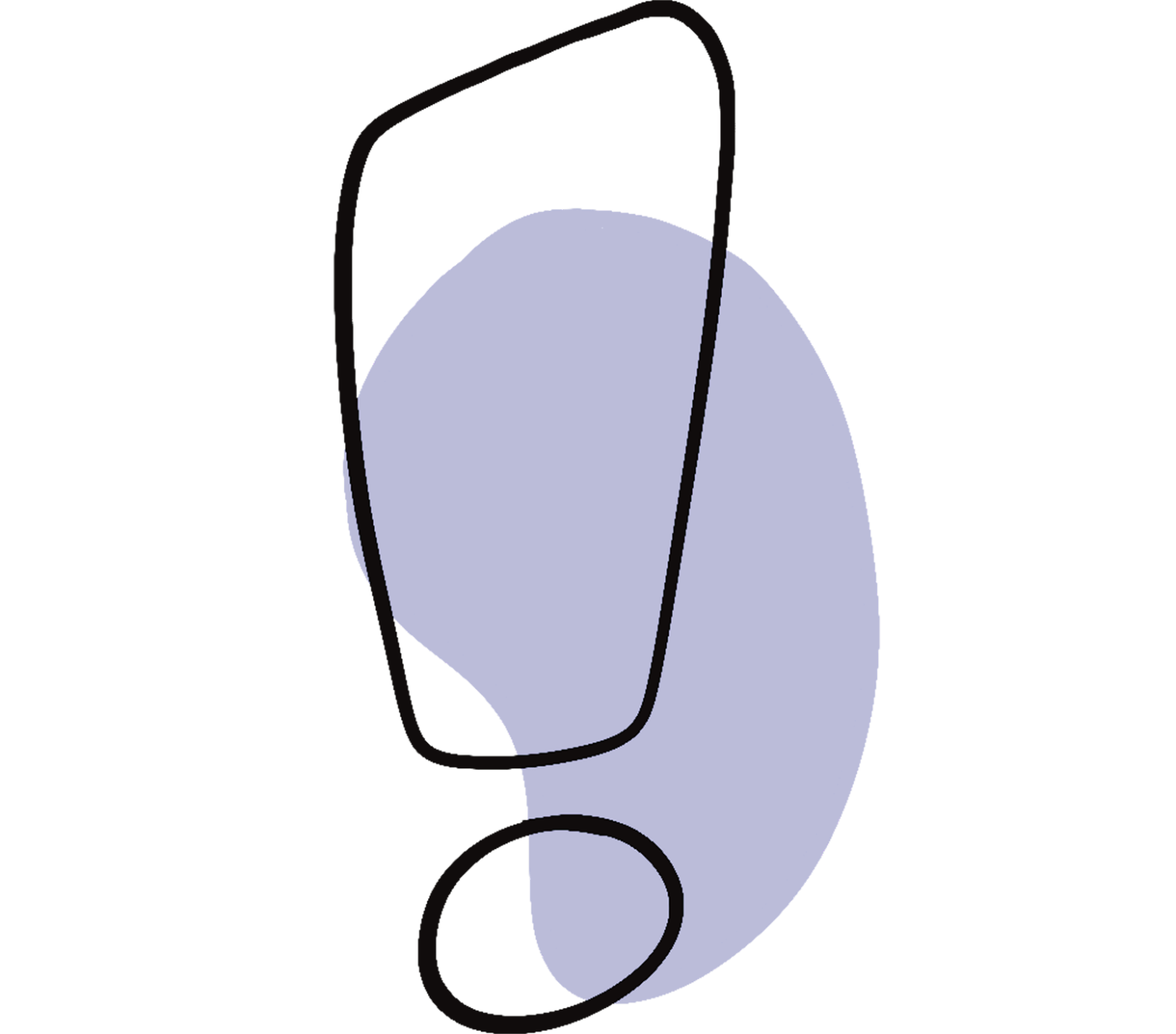
Was schreibe ich in eine Einleitung?
Eine Einleitung enthält klassischerweise: Hinführung zum Thema, Formulierung der Fragestellung und der Zielsetzung, Beschreibung der Vorgehensweise (Methode), und einen Ausblick auf die Struktur der Arbeit.
Was kommt vor der Einleitung?
Der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit besteht aus: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil, Fazit und Literaturverzeichnis. Vor der Einleitung steht also in der Regel das Inhaltsverzeichnis.
Wie lang ist eine Einleitung?
Die Einleitung sollte nicht mehr als 10–15 Prozent des Gesamttextes umfassen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im April 2025 und zuletzt aktualisiert im April 2025.