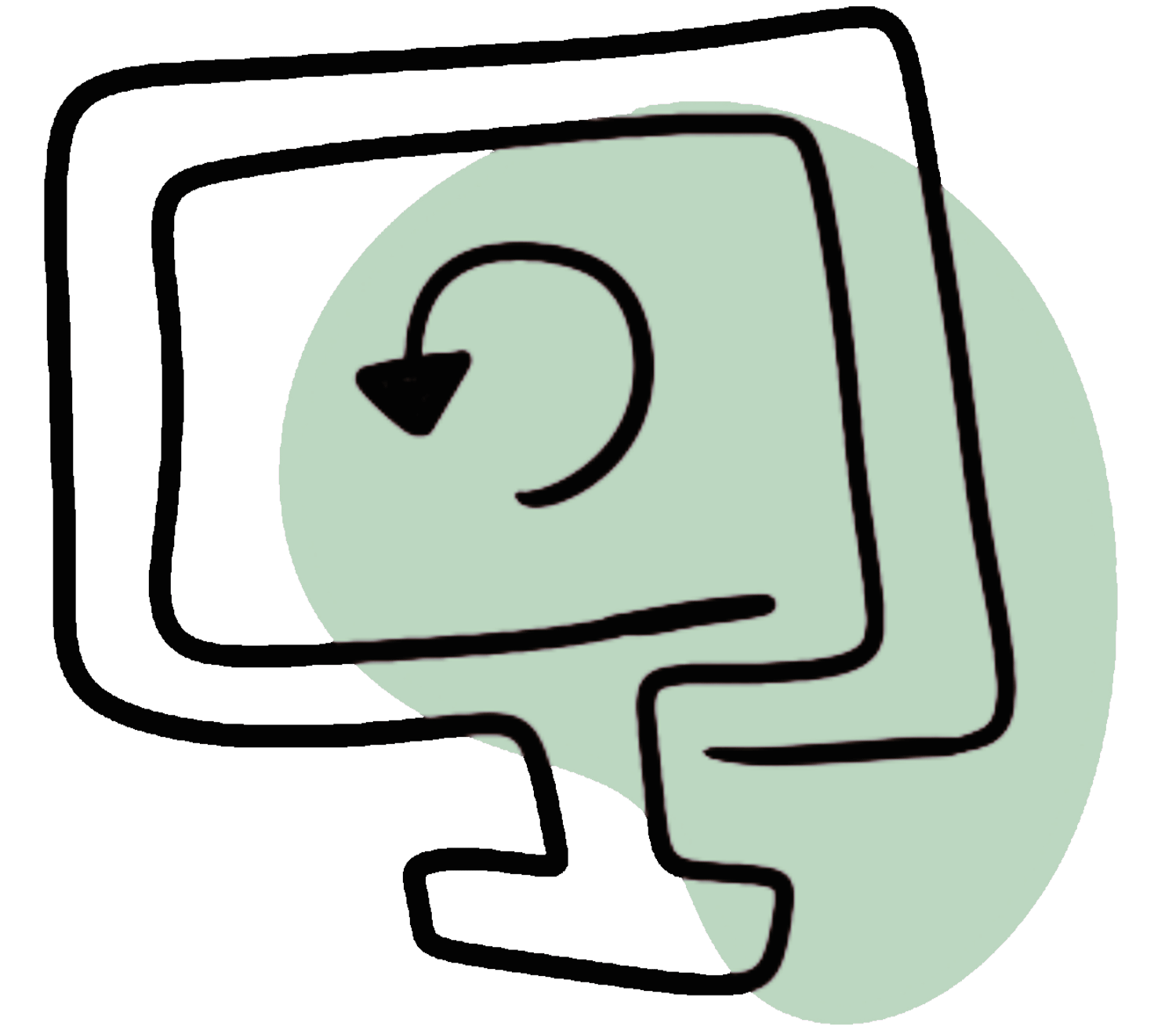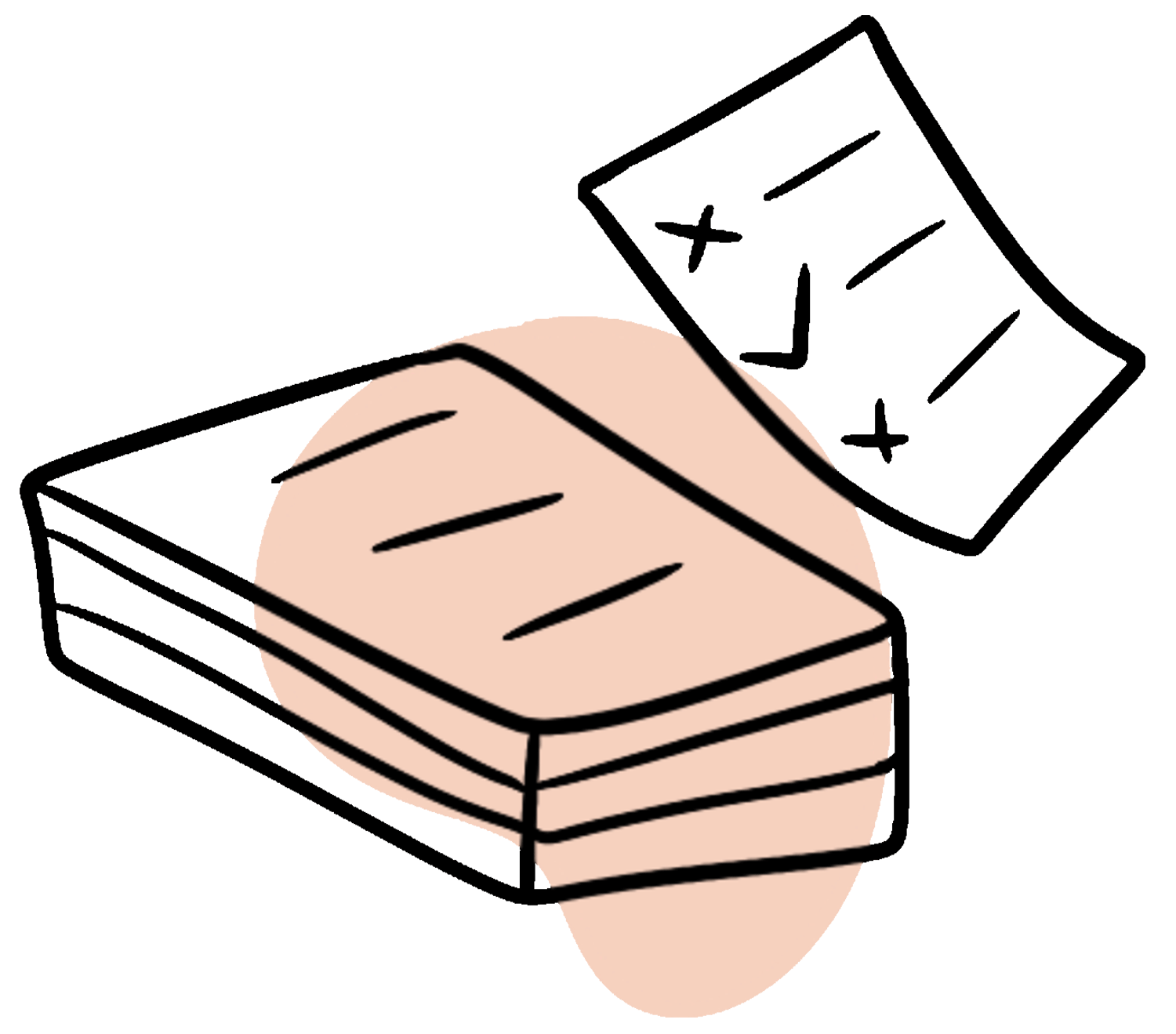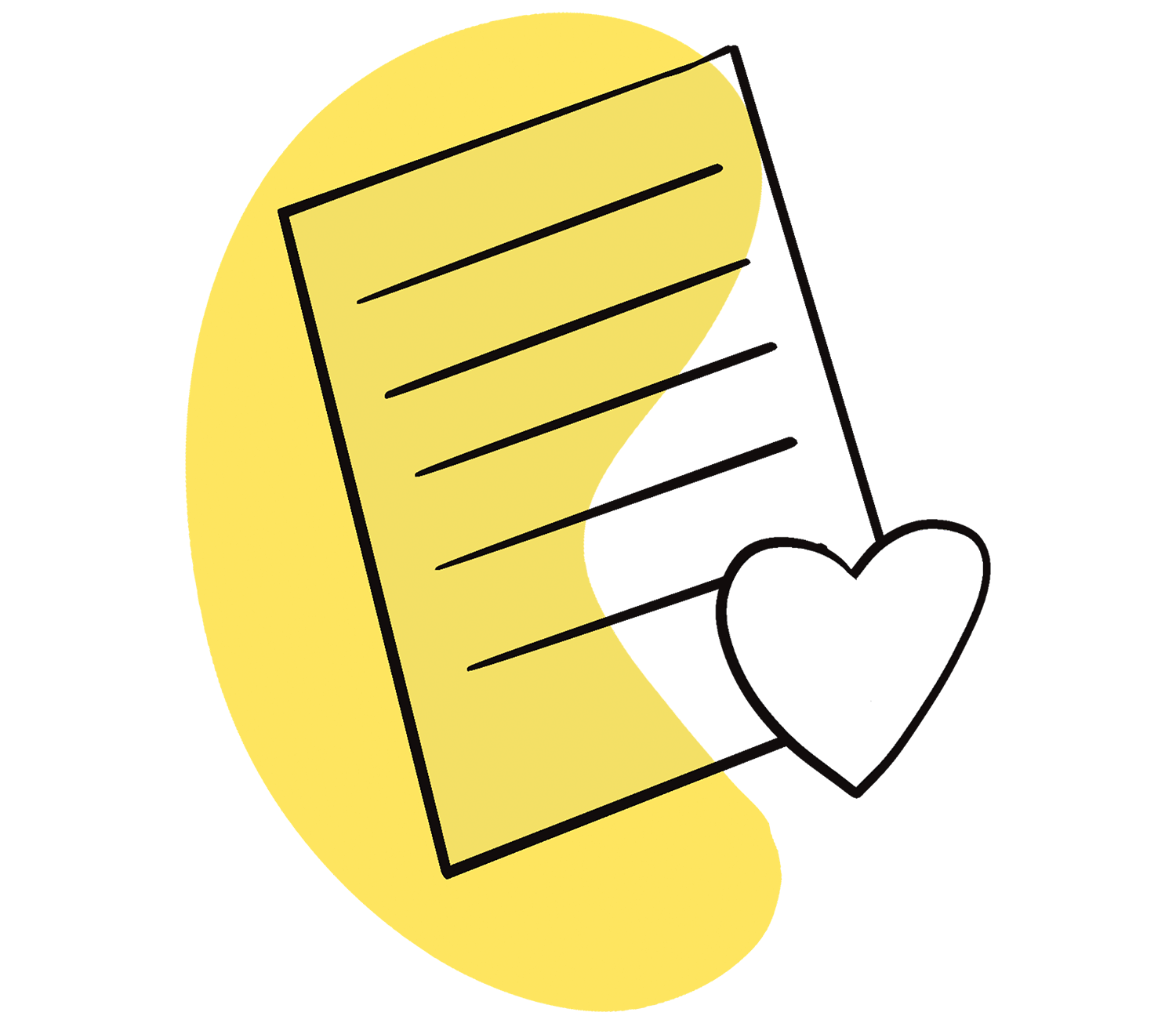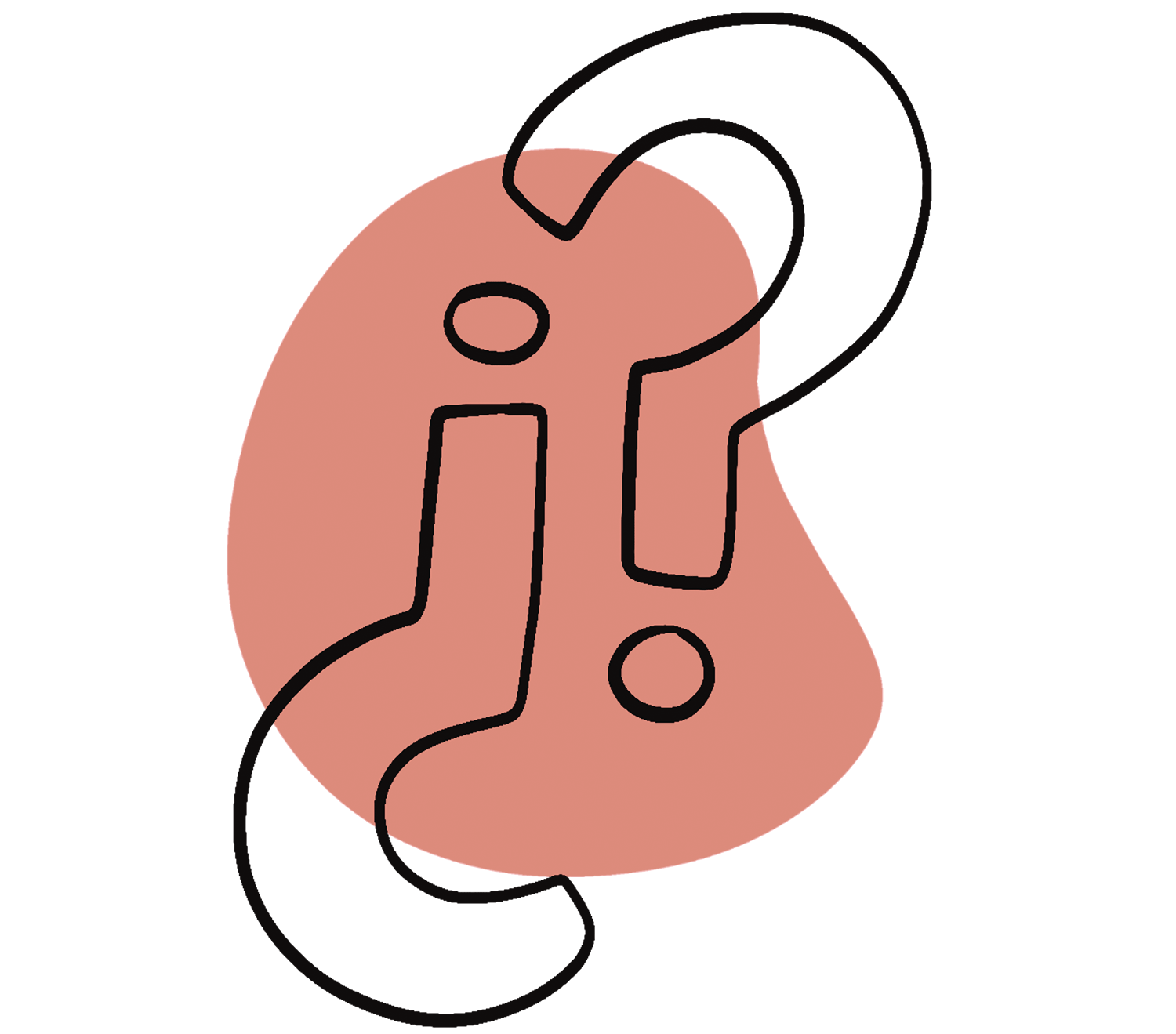Egal, ob bewusst oder unbewusst: In der Wissenschaft widersprechen Plagiate den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens. Zu den Konsequenzen gehören nicht bestandene Prüfungen, in schwerwiegenden Fällen auch Exmatrikulation und gescheiterte Karrieren in Wissenschaft und Politik.
Die häufigsten Formen von Plagiaten sind:
1. Direktes Plagiat oder Vollplagiat:
Das wörtliche Kopieren von Textpassagen ohne Anführungszeichen und ohne Quellenangabe.
2. Mosaikplagiat oder Patchwork-Plagiat:
Die Zusammenstellung von Textfragmenten aus verschiedenen Quellen, die ohne Zitate und Quellenangaben in den eigenen Text eingefügt werden.
3. Paraphrasenplagiat:
Das Umschreiben von Texten anderer in eigenen Worten ohne angemessene Quellenangabe. Auch wenn der Wortlaut verändert wird, bleibt die Idee oder der Gedankengang des Originaltextes erhalten und muss daher zitiert werden.
4. Strukturplagiat:
Das Übernahme von Gliederungen, Strukturen oder Argumentationsketten anderer Texte ohne darauf hinzuweisen.
5. Ideenplagiat:
Die Verwendung von Ideen, Konzepten, Theorien oder Forschungsergebnissen anderer, ohne diese zu zitieren. Auch wenn keine genauen Textpassagen kopiert werden, muss die Quelle der verwendeten Ideen angegeben werden.
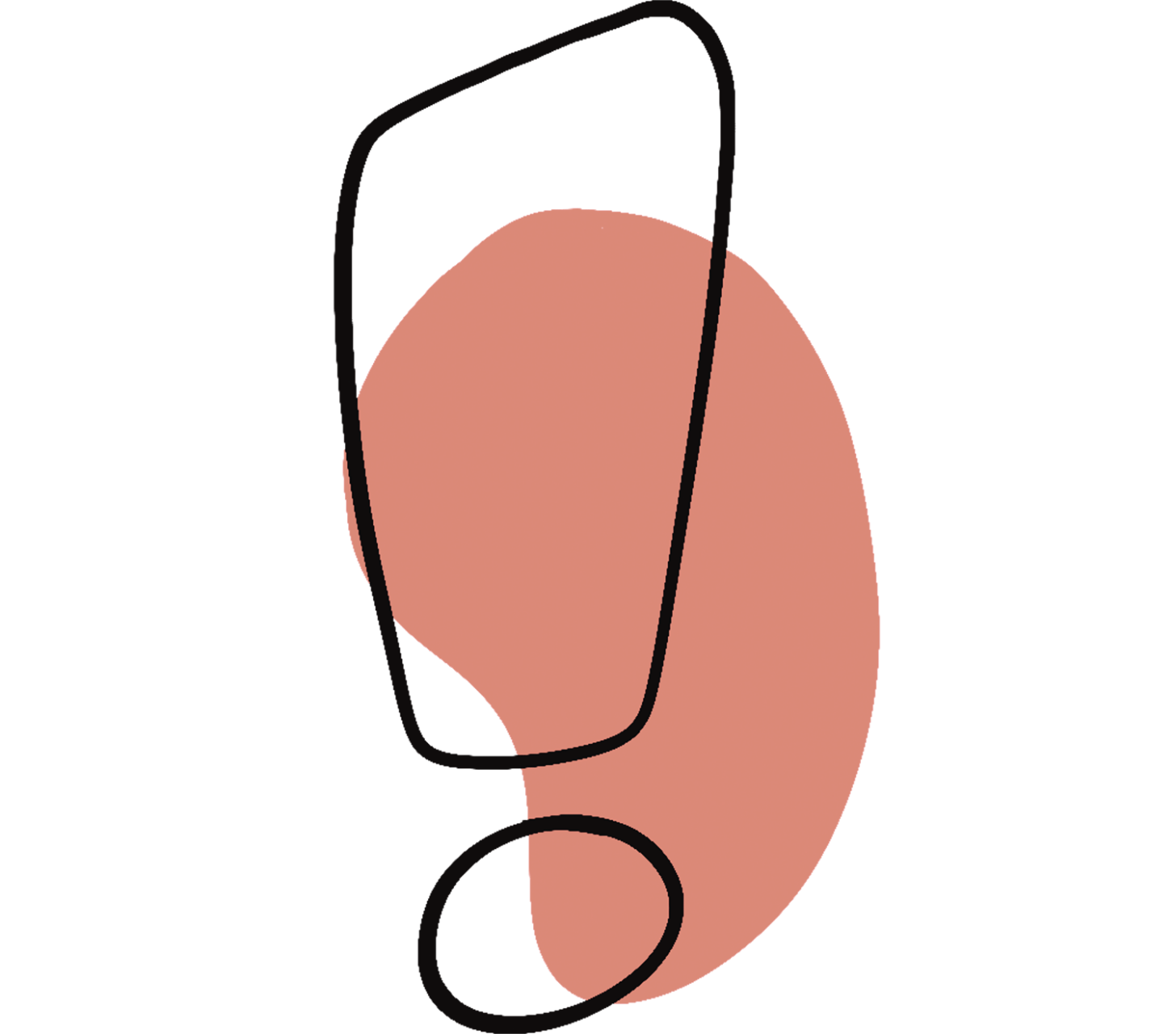
Ob du zum Beispiel bei der Übernahme einer Struktur oder eines Gedankens die Quellen angibst, hängt von der sogenannten Schöpfungshöhe ab:
Wenn du allgemein bekanntes, unumstrittenes Wissen in deinem Fach präsentierst, ist in der Regel keine Quellenangabe erforderlich. Manchmal ist es schwer herauszufinden, ob etwas zu diesem Grundwissen im Fach gehört. Zitiere im Zweifel lieber zuviel als zuwenig.
Wenn es jedoch ein origineller Gedanke, eine konkrete Zahl, ein Modell oder eine Theorie, die sich auf eine Person zurückführen lässt, handelt, musst du die Herkunft durch eine Quellenangabe deutlich machen.
Das gilt auch für eine Strukturübernahme. Wenn du eine innovative Gliederung aus der Fachliteratur übernimmst, kannst du zum Beispiel im Fließtext der Einleitung darauf hinweisen, dass du dich bei der Gliederung an Quelle XY angelehnt hast.
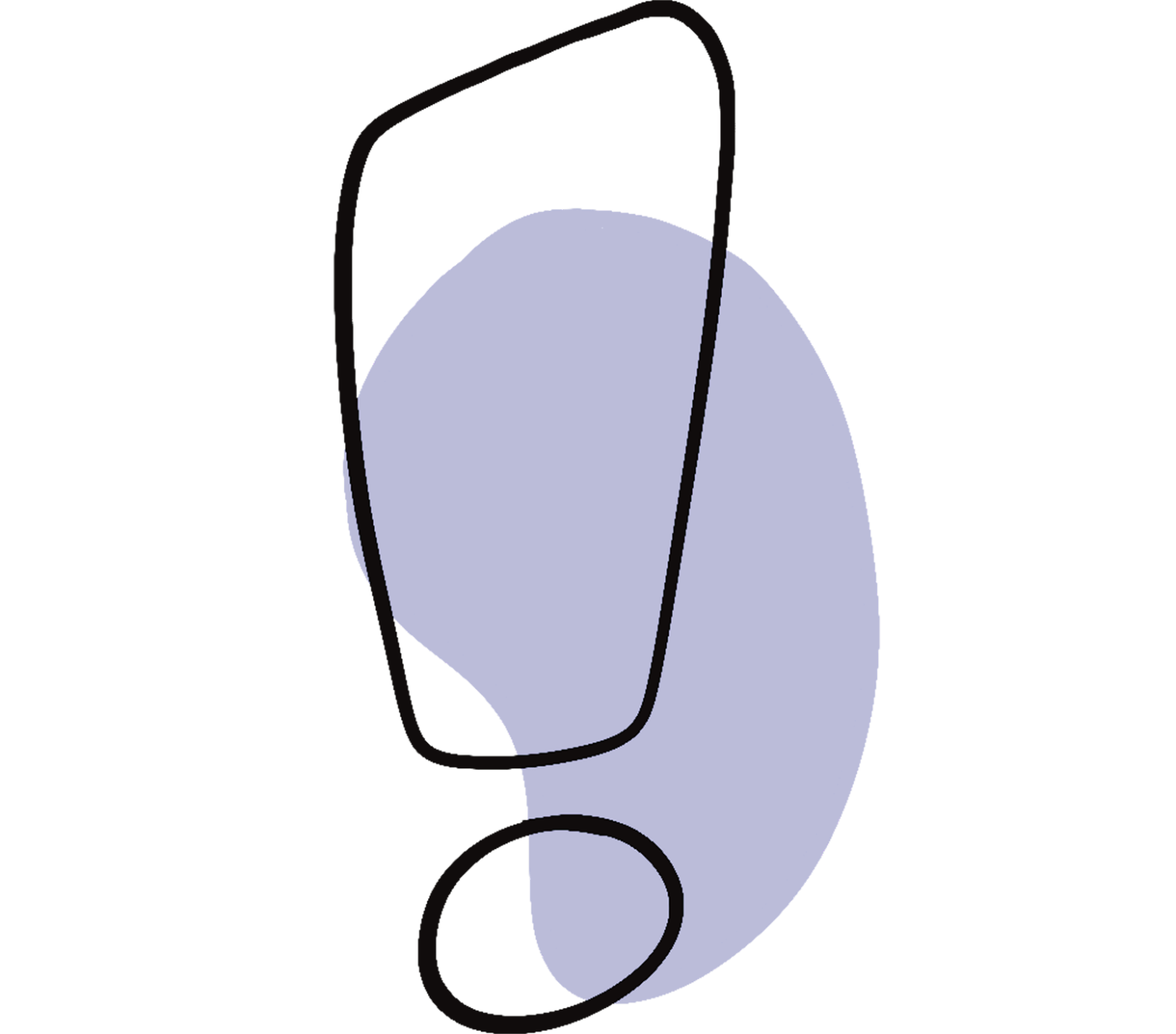
Vielleicht hast du schon gelesen, dass generative KI keine Plagiate erzeugt, sondern Unikate. Und das stimmt auch – diese großen Sprachmodelle kopieren nicht einfach Sätze aus ihren zahlreichen Trainingsdaten, sondern erzeugen auf jeden Prompt gemäß statistischen Prinzipien einen neuen, eigenen Text.
In der Regel erzeugen KI-Schreibtools also keine wortwörtlichen Plagiate. Trotzdem generieren KI-Schreibtools Texte, die teilweise oder vollständig auf vorhandenen Inhalten basieren.
Problematisch sind vor allem folgende Praktiken:
- Wenn du Fachliteratur umformulieren oder zusammenfassen lässt, musst du immer die Quelle angeben. Ansonsten ist es ein Plagiat.
- Wenn du generierte Texte direkt aus KI-Tools übernimmst, erkennst du möglicherweise nicht, dass diese Inhalte auf bestehenden Arbeiten basieren.
- KI-Tools bieten in der Regel keine oder sogar falsche Quellenangaben für die erzeugten Texte, was die Gefahr von Plagiaten erhöht.
Um Plagiate beim Einsatz von KI-Schreibtools zu vermeiden, solltest du folgende Strategien beachten:
1. Recherchiere sorgfältig:
Wissenschaft beruht stets auf den Vorarbeiten anderer. Es ist deine akademische Pflicht, umfassend zu recherchieren und zur Kenntnis zu nehmen, was bereits zu diesem Thema erforscht wurde. Dies erlaubt dir dann auch, in den KI-generierten Texten die Ideen anderer zu identifizieren.
2. Arbeite eigenständig:
Nutze KI-Tools als Hilfsmittel, nicht als Ersatz für eigenes Denken und Schreiben. Oft ist es gerade bei wissenschaftlichen Texten ratsam, deine Entwürfe selbst zu verfassen und die KI nur zur Überarbeitung oder Ergänzung zu nutzen.
3. Gib Quellen an:
Stelle sicher, dass alle Informationen, die nicht deinem eigenen Wissen entstammen, korrekt zitiert werden. Recherchiere Inhalte nach, die du aus einem KI-Tool wie ChatGPT übernimmst, und belege sie mit Quellen. Zur Unterstützung deiner Literaturrecherche kannst du auch Literaturrecherche-KI-Tools wie ConnectedPapers, Consensus oder ResearchRabbit nutzen.
4. Reflektiere deinen Schreibprozess:
Analysiere regelmäßig deinen Schreibprozess und reflektiere, wie und warum du KI-Tools einsetzt. Dies fördert das Bewusstsein für die eigenen Arbeitsweisen und hilft, unethisches Verhalten zu vermeiden.
5. Nutze Beratungen und Schulungen:
Viele Hochschulen bieten Workshops und Beratungen zum Thema Plagiatsvermeidung an. Nimm diese Angebote wahr, um deine Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
Muss ich genutzte KI-Tools im Literaturverzeichnis als Quelle angeben?
Letztlich entscheiden darüber deine Betreuenden. In der Regel wird gefordert, dass KI-Tools als Hilfsmittel angegeben werden, nicht aber als Quelle.
Welche KI-Tools eignen sich wofür?
Sieh dir dazu unseren Artikel über: KI-Tools für wissenschaftliche Arbeiten an.
Der Artikel wurde veröffentlicht im Januar 2025 und zuletzt aktualisiert im Januar 2025.