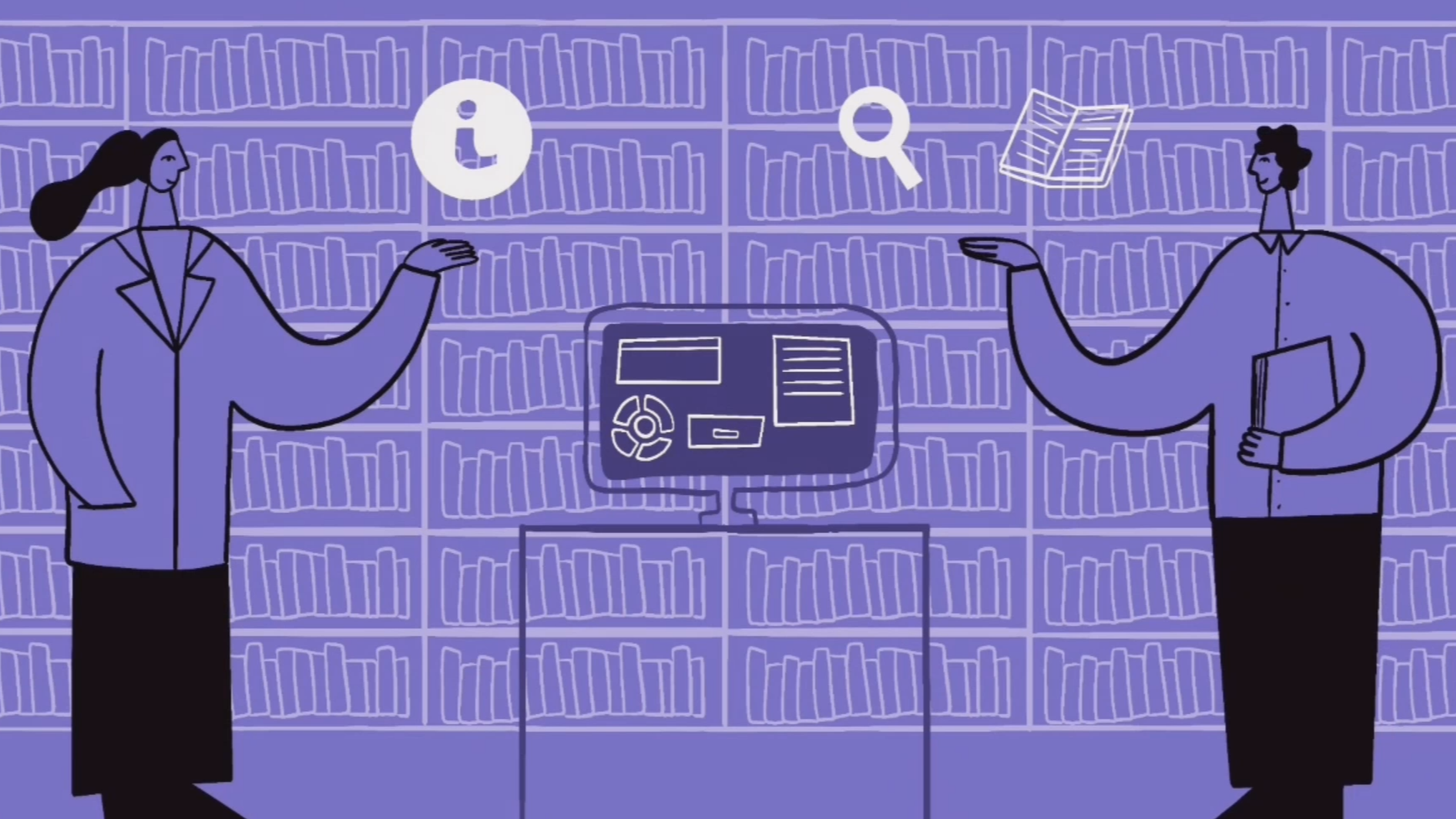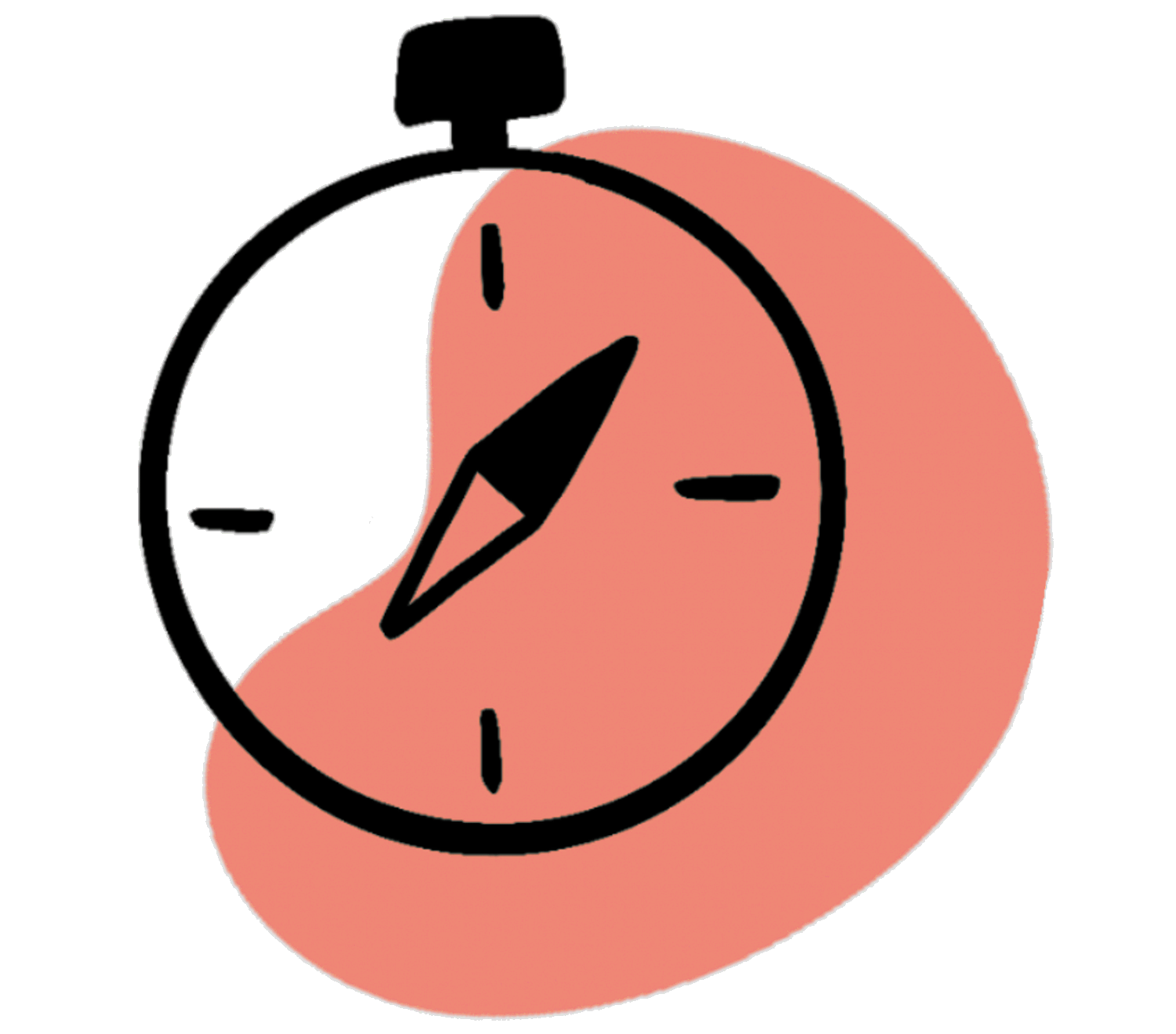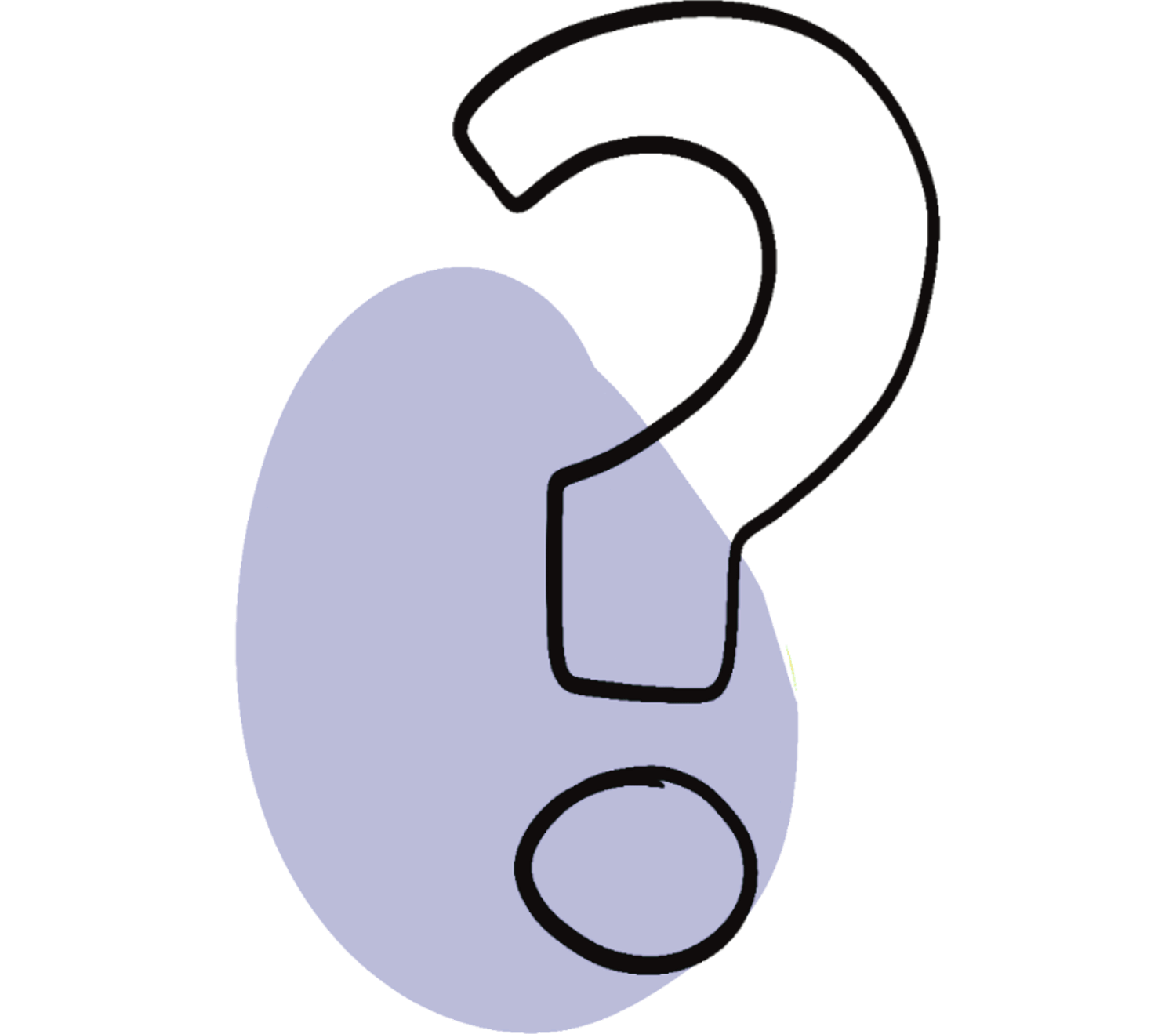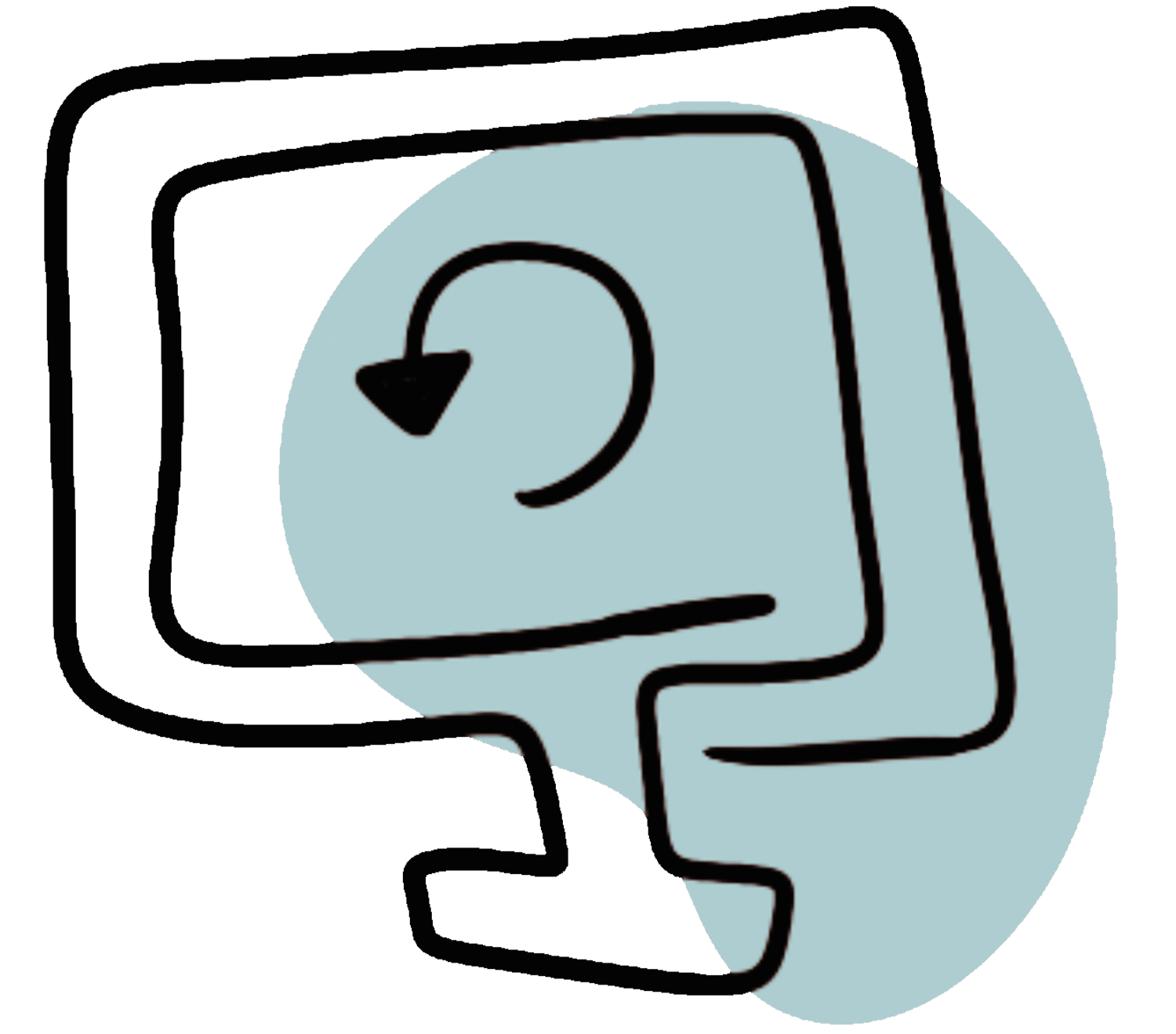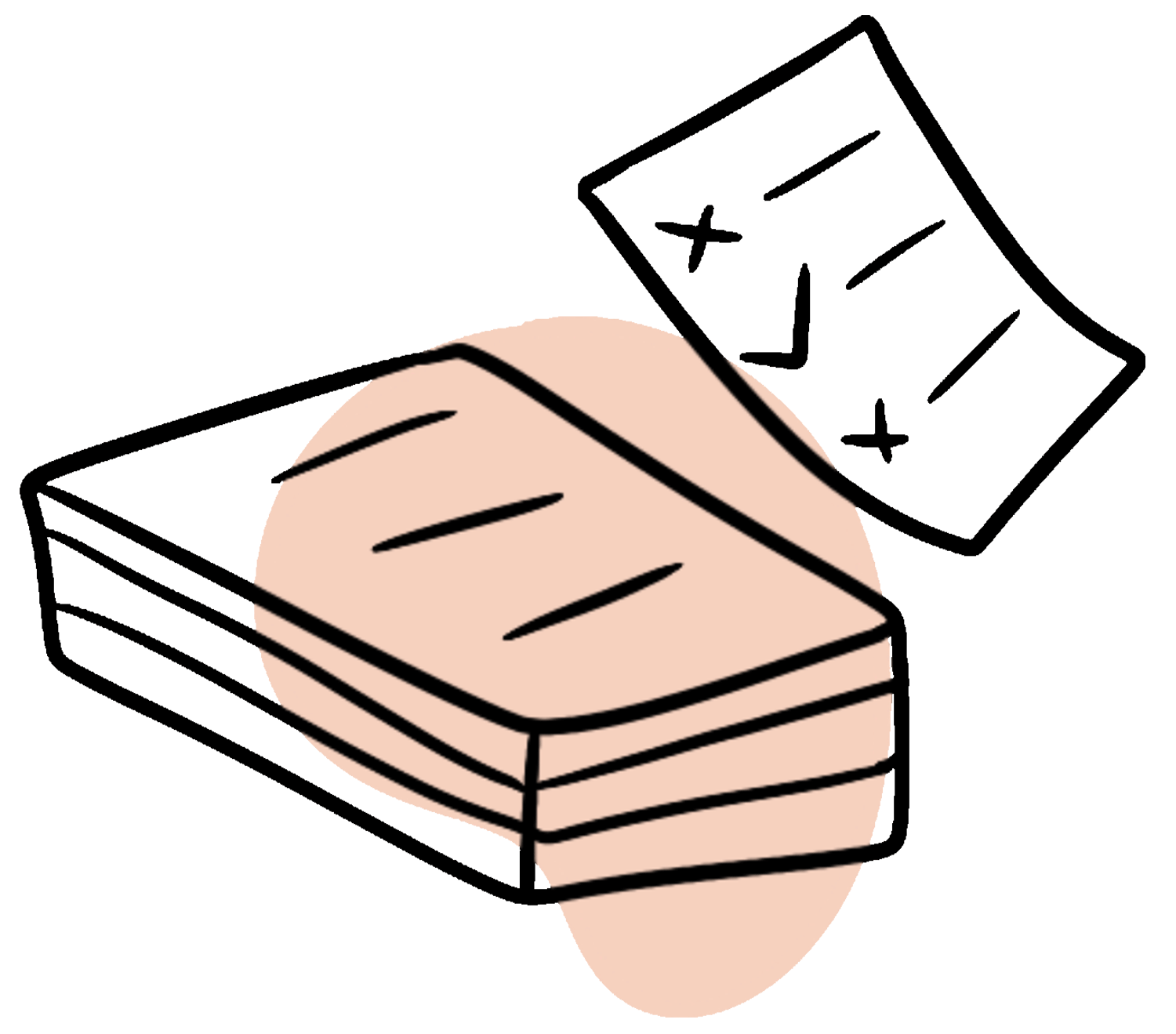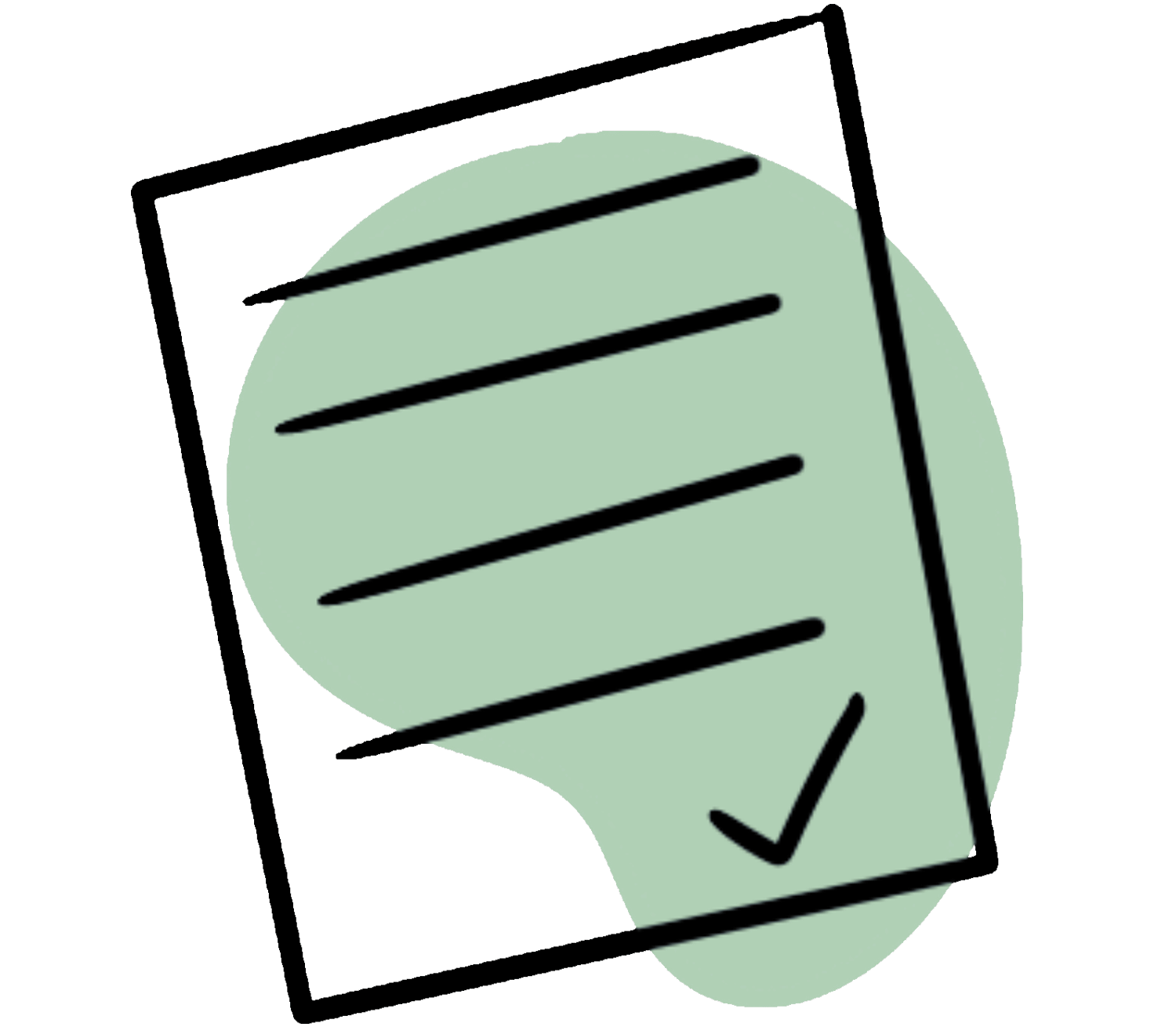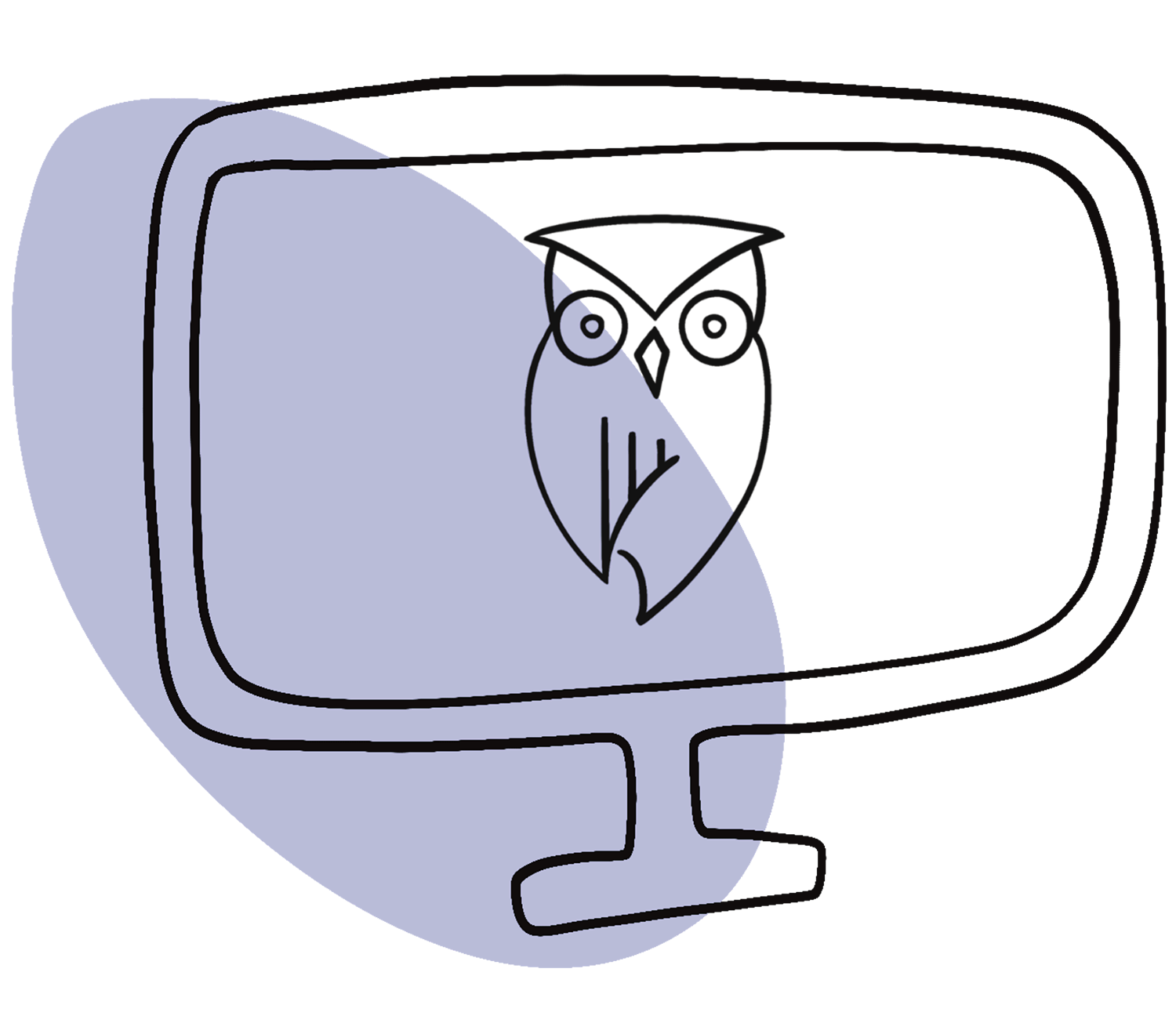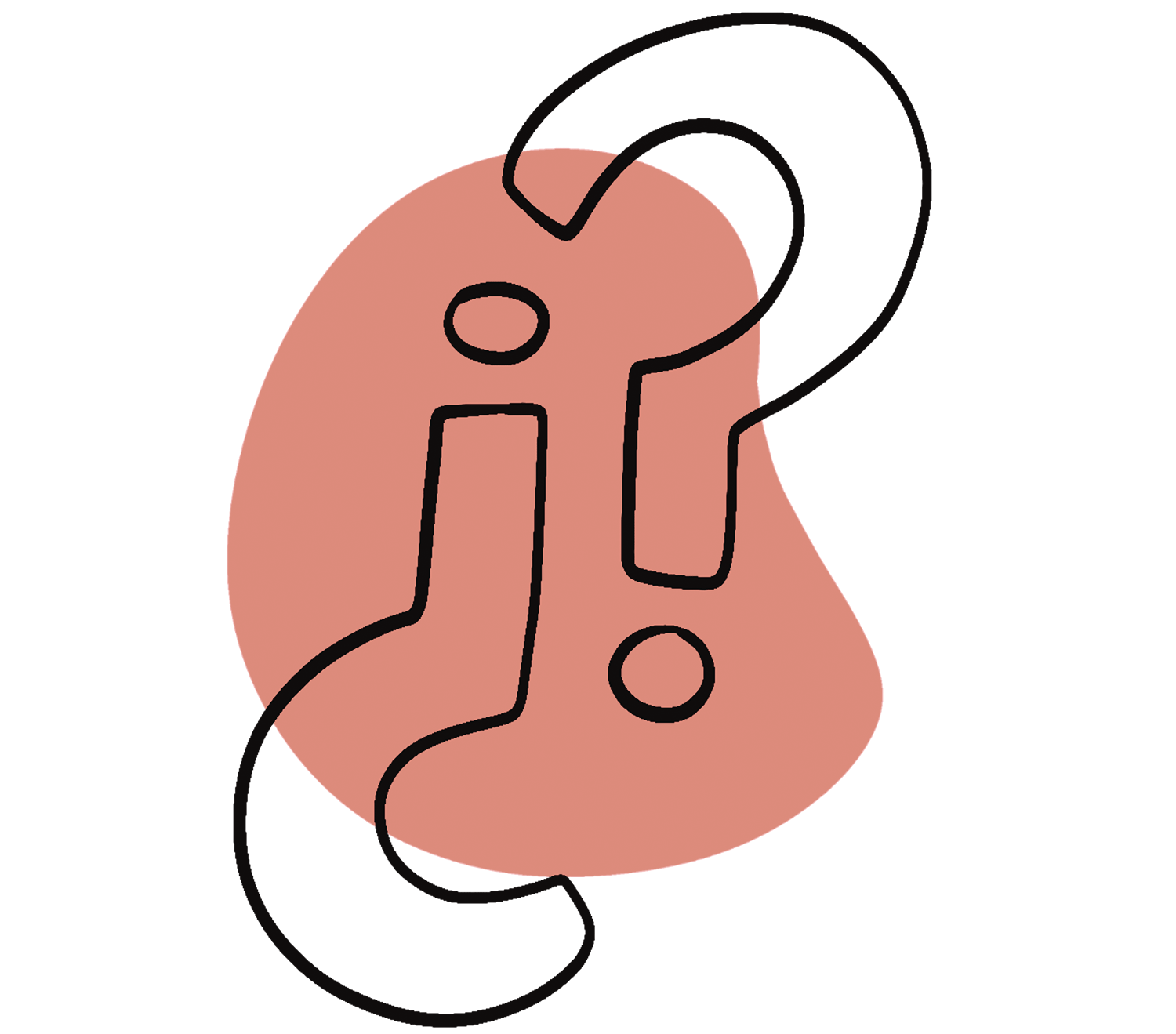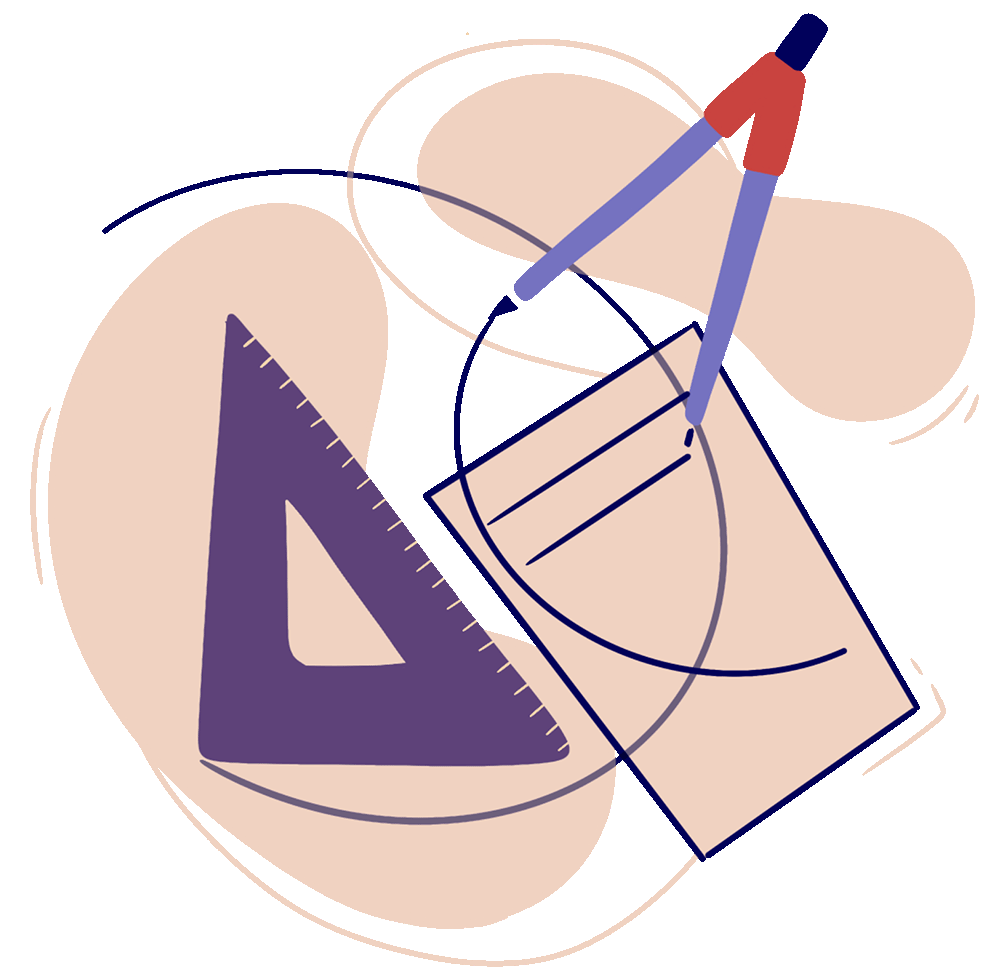Damit die Lesenden deinen ingenieurwissenschaftlichen Text so verstehen, wie er gemeint ist, sollte er folgende Eigenschaften haben:
- Unpersönlicher Schreibstil
- Sachbezogene Formulierungen
- Belegte Inhalte
- Neutrale Ausdrucksweise
- Präzise und eindeutig
- Kurz und prägnant
- Formaler Schreibstil
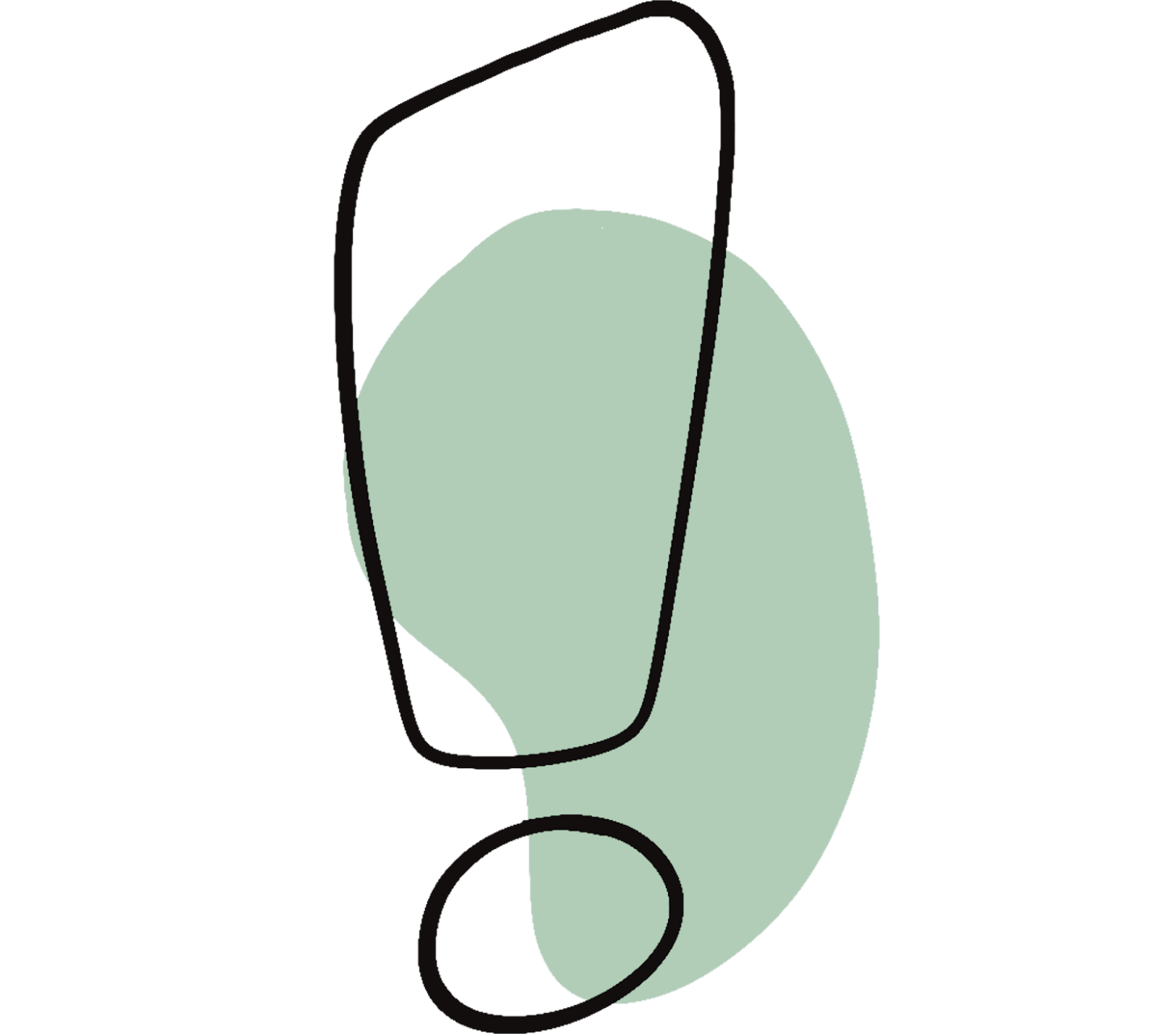
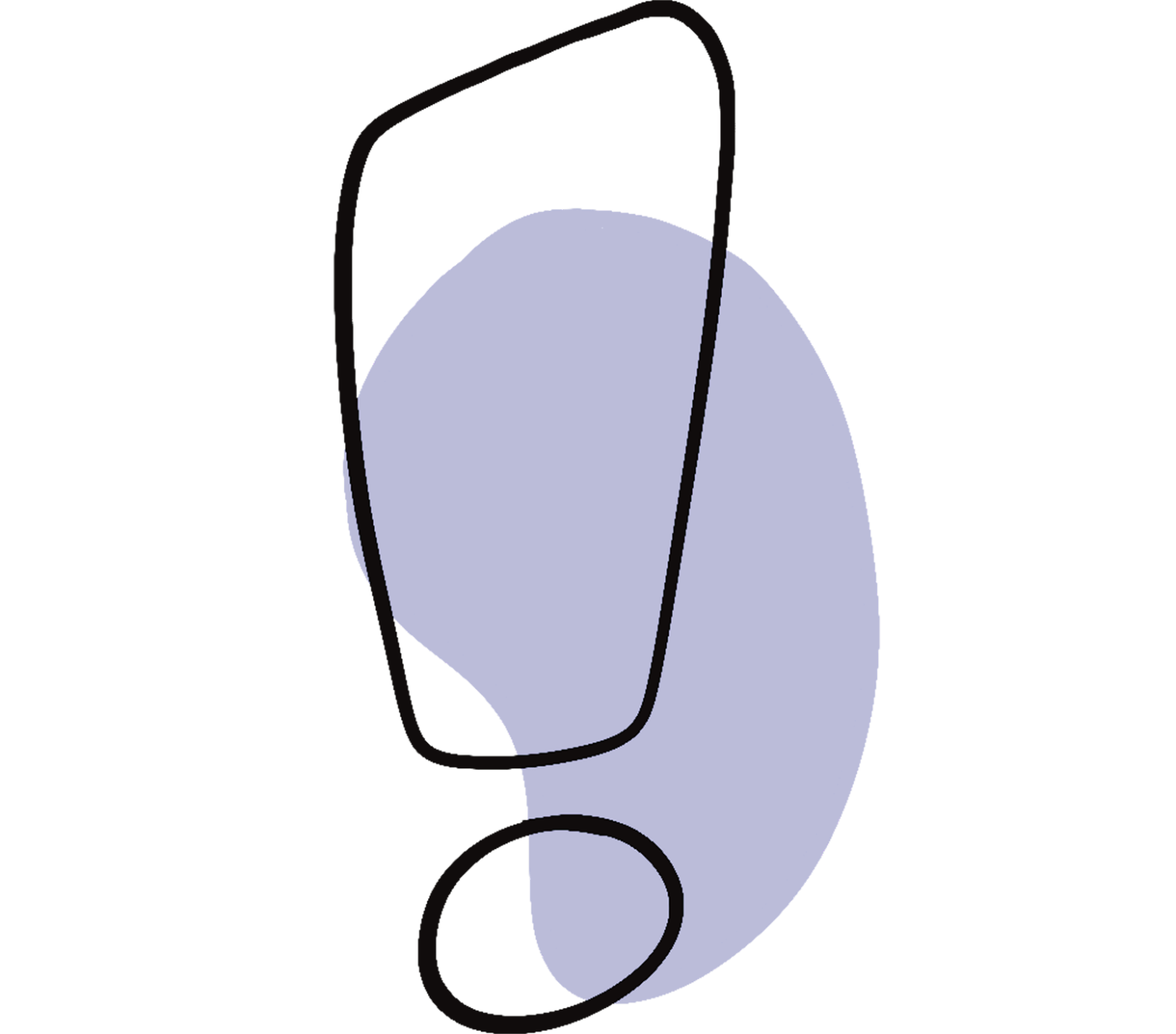
Vermeide es daher auch, die Lesenden durch die erste Person Plural „wir“ in den Text einzubeziehen oder mit rhetorischen Fragen anzusprechen. Das unpersönliche Pronomen „man“ stellt keine Alternative dar, denn damit wird eine Verallgemeinerung formuliert. Nur, wenn du tatsächlich eine Allaussage treffen kannst, darfst du „man“ verwenden, z. B. „Man unterscheidet …“.
Beispiel:
Negativbeispiel: „Nachdem ich die Berechnung erstellt hatte, musste ich sie meinen Team-Mitgliedern vorstellen, um sicherzugehen, dass ich auch alles berücksichtigt hatte.“
Das Pronomen „ich“ ist in ingenieurwissenschaftlichen Texten zu vermeiden. Häufig eignen sich hier Formulierungen im Passiv:
„Nach Erstellung der Berechnung wurde diese im Team diskutiert, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Aspekte berücksichtigt wurden.“
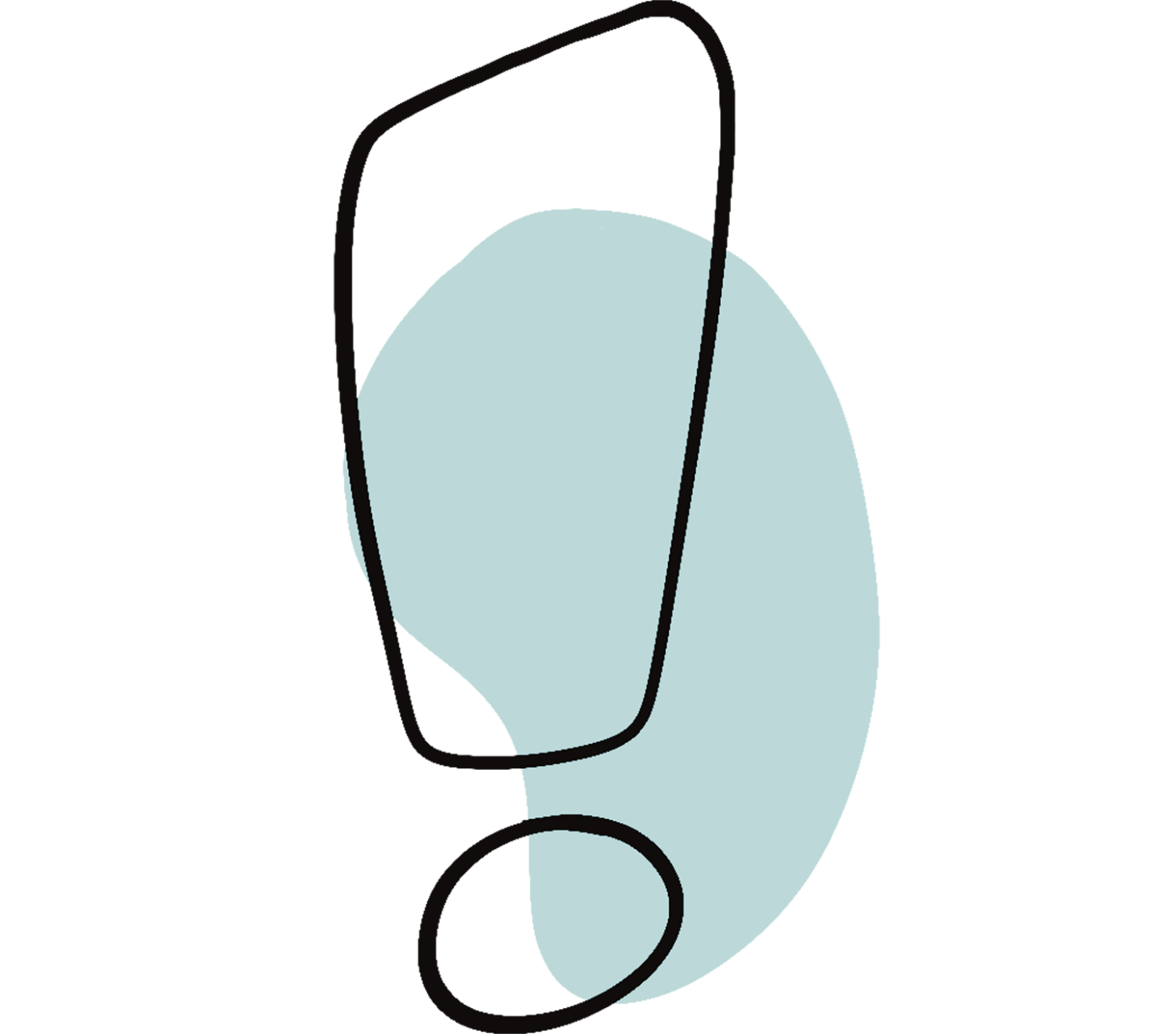

Stelle keine Vermutungen an. Behauptungen sind als solche zu kennzeichnen.
Beispiel:
Negativbeispiel: „Der Dämpfungsterm ist jedoch vermutlich kleiner als die Reibkräfte, und kann deshalb im Modell vernachlässigt werden.“
Gib Belege, anstatt zu vermuten:
„Der Dämpfungsterm ist nach [XY] kleiner als die Reibkräfte, und kann deshalb im Modell vernachlässigt werden.“
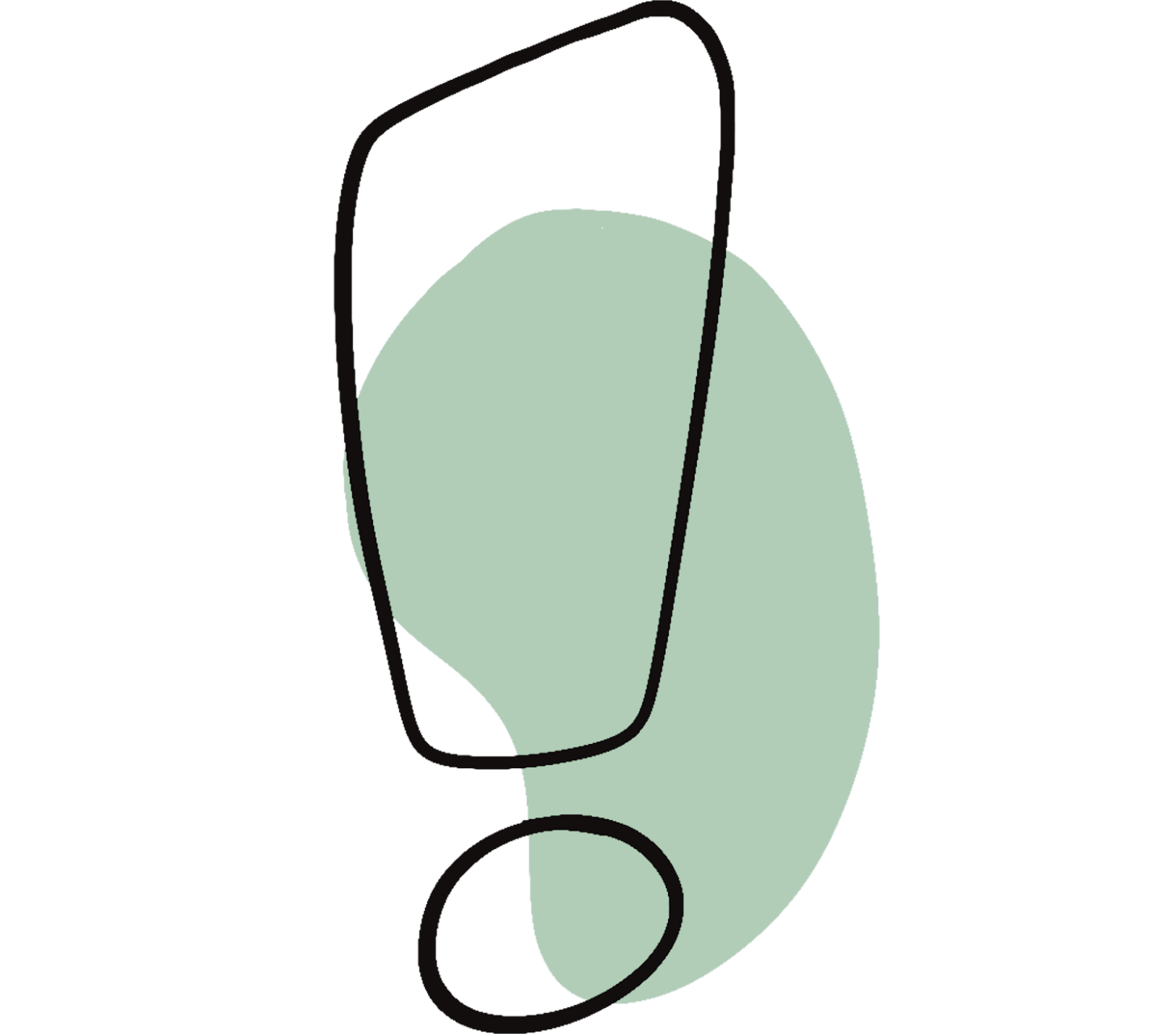
Wenn du Wertungen vornimmst, muss dies an geeigneter Stelle und explizit erfolgen, z. B. „Verfahren XY ist für diese Anforderung nicht geeignet, weil …“
Beispiel:
Negativbeispiel: „Ein zweiter vernünftiger Ansatz ist es, einen Linienkontakt zwischen Laufpin und Kontur anzunehmen.“
Das Adjektiv „vernünftig“ ist hier vage und wertend. Insgesamt ist der Satz unnötig lang und umständlich. Bringe wichtige Information im Hauptsatz unter:
„Ein zweiter Ansatz nimmt einen Linienkontakt zwischen Laufpin und Kontur an.“
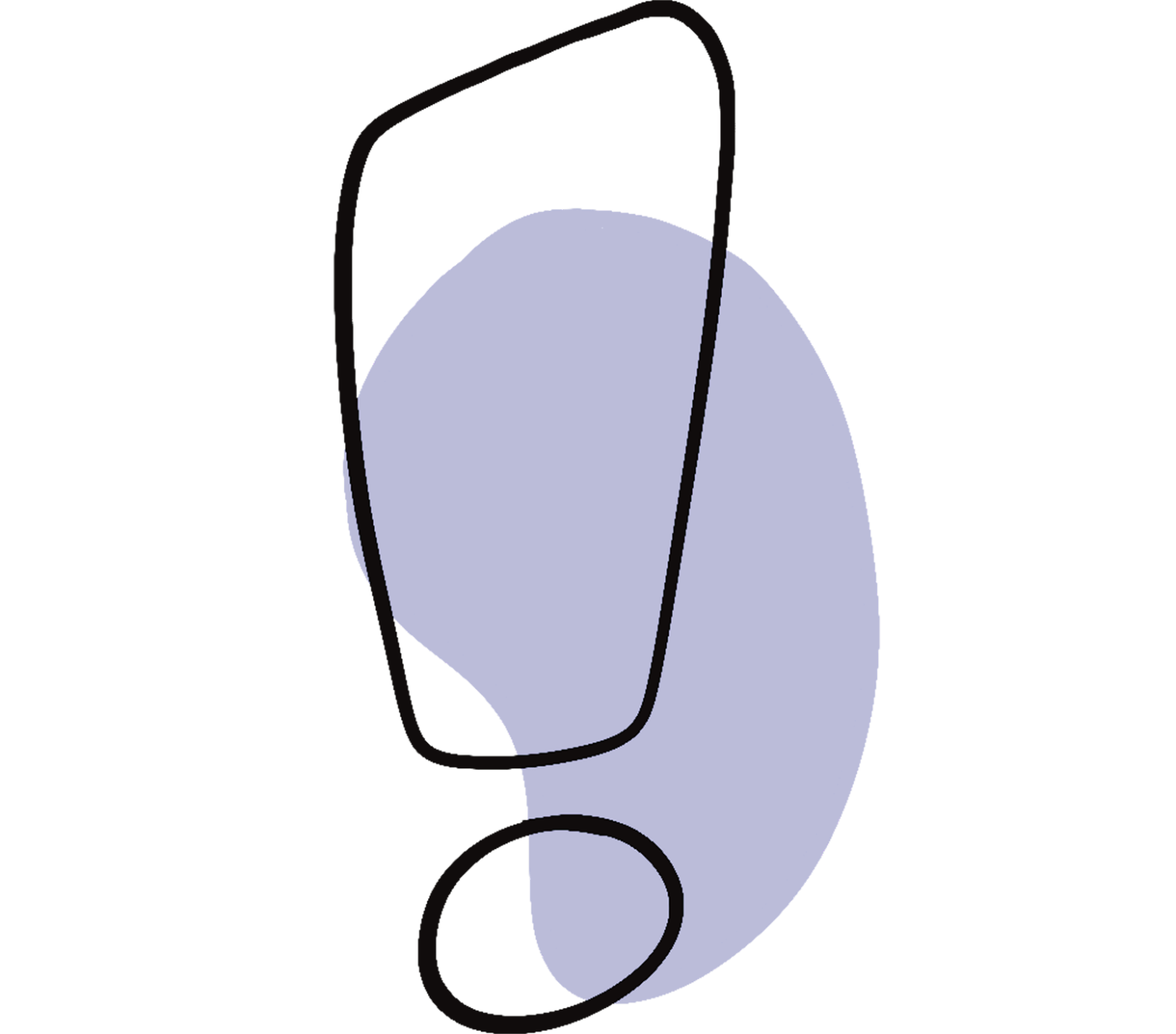
Auch wenn eine verständliche Sprache gefordert ist, gilt: Du schreibst eine Arbeit für ein Fachpublikum. So wirst du evtl. auch in der späteren Praxis Texte verfassen, die von Fachleuten gelesen werden (z. B. Berichte), und die von Laien nicht verstanden werden müssen. Fachbegriffe sollten jedoch eingeführt und definiert werden, sofern sie nicht eindeutig sind.
Beispiel 1:
Negativbeispiel: „Bei unserer letzten Messung ergab sich eine Störung, die das Signal so stark verfälscht hat, dass wir es nicht mehr auswerten konnten.“
„Verfälschen“ oder „stören“ sind Nebelgranaten. Nenne die konkrete Ursache:
„Bei der letzten Messung kam es aufgrund einer zu niedrigen Abtastfrequenz zu Aliasing.“
Beispiel 2:
Negativbeispiel: „Die Abstände, die durch die Laufzeiten der Ultraschallaufnahmen im A-Mode berechnet wurden, stimmen mit den abgemessenen Abständen ziemlich genau überein, allerdings gibt es trotzdem Abweichungen, diese befinden sich aber im Mikrometerbereich.“
Die Wendung „ziemlich genau“ ist unpräzise und unwissenschaftlich. Quantitative Aussagen sind qualitativen Aussagen oft vorzuziehen. Der zweite Halbsatz mit den Abweichungen im Mikrometerbereich ist für wissenschaftliches Schreiben trivial und wirkt hier unangebracht. Besser wäre es so:
„Die Abstände, die aus den Laufzeiten der Ultraschallaufnahmen im A-Mode berechnet wurden, weichen maximal um 4 % von den mit dem Messschieber gemessenen Abständen ab.“
Beispiel 3:
Negativbeispiel: „Um zu bestimmen, ob ein Gleichungssystem A·x = b
(wobei A eine (nxn)-Matrix ist) für jedes b genau eine Lösung x hat, muss man die Determinante bestimmen. Ist diese ungleich Null, so gibt es für jedes b genau ein x, sodass A·x = b gilt.“
Bei mathematischen oder physikalischen Zusammenhängen sind Formeln häufig präziser als Ausformulierungen:
„Das (nxn)-Gleichungssystem A·x = b ist genau dann eindeutig lösbar, wenn gilt: det(A) = 0.“
Wissenschaftliche Texte sind Arbeitsdokumente, die gut verständlich sein sollten. Formuliere deshalb so kurz und prägnant wie möglich.
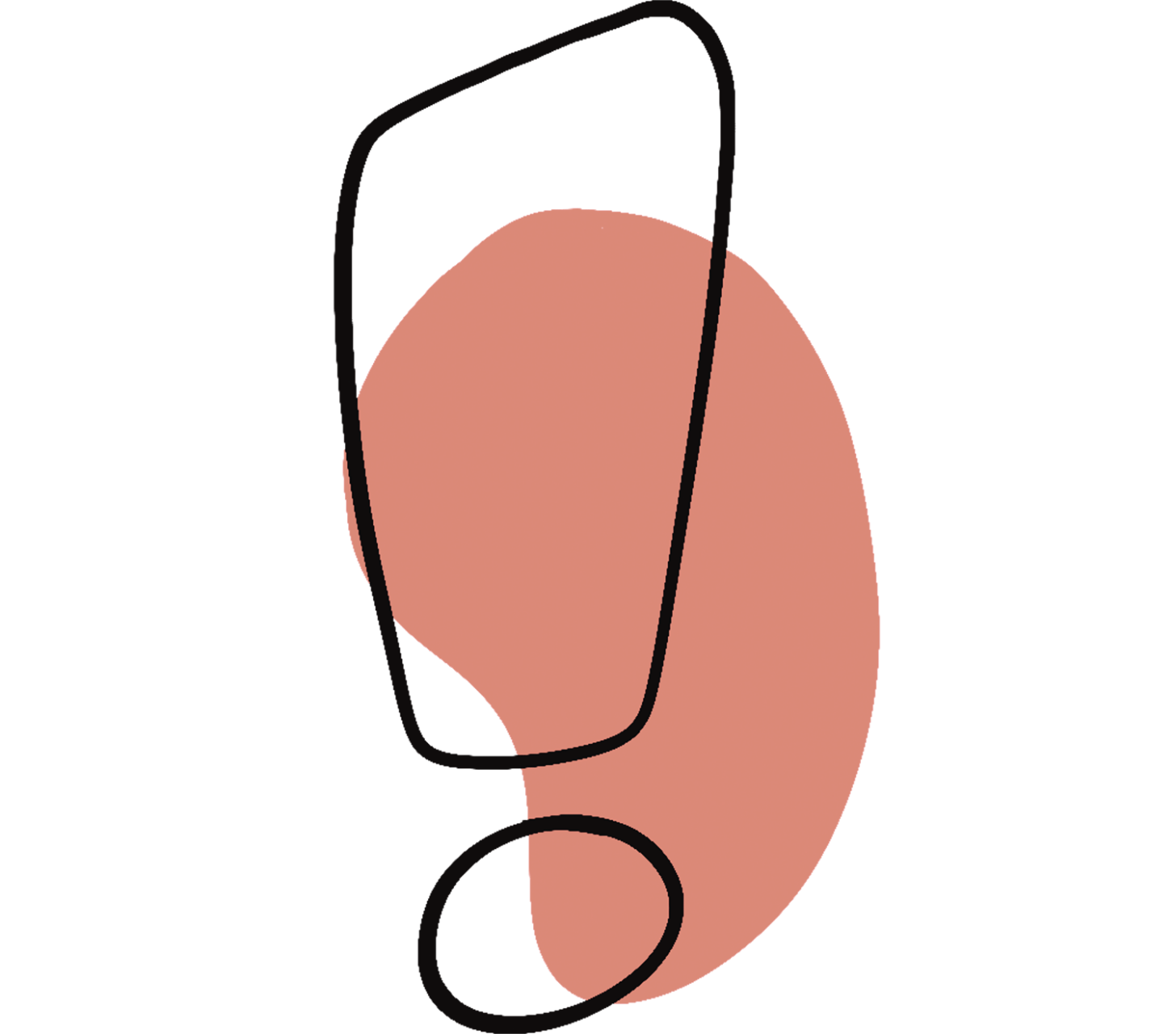
Selbstverständliches sollte nicht dargestellt werden: Ein Sachverhalt gilt als selbstverständlich, wenn er der breiten Masse der Absolvierenden deines Studienganges bekannt ist – oder zumindest bekannt sein sollte.
Beispiel 1:
Negativbeispiel: „Die Anzahl der benötigten Zustandsgrößen ergibt sich aus der Anzahl der Freiheitsgrade und eventuell weiterer Größen, welche nicht für jeden Rechenschritt direkt berechenbar sind. Im Nachfolgenden werden die einzelnen Komponenten auf ihre Freiheitsgrade hin untersucht, wobei ein Freiheitsgrad allgemein als unabhängige verallgemeinerte Koordinate definiert ist.“
Die Definition gehört an den Anfang. Streiche Füllwörter wie „benötigten“, „eventuell weiterer“, „direkt“ oder „allgemein“. Wähle einfache Ausdrücke wie „die“ statt „welche“ und „Im Folgenden“ statt „Im Nachfolgenden“. Formuliere kurze Sätze, anstatt die wichtige Definition mit „wobei“ in einem Nebensatz anzuhängen. Besser also:
„Ein Freiheitsgrad ist eine unabhängige verallgemeinerte Koordinate. Die Anzahl der Freiheitsgrade bestimmt die Anzahl der Zustandsgrößen. Hinzu kommen die Größen, die nicht für jeden Rechenschritt berechenbar sind. Im Folgenden werden die Freiheitsgrade der einzelnen Komponenten untersucht.“
Beispiel 2:
Negativbeispiel: „Über Leitungsverbindungen erfolgt die Verbindung der Bauteile mit den Halbleiterrelais und dem Arduino-Board.“
Dieser Satz ist überflüssig. Dass die Bauteile mit „Leitungsverbindungen“, also Kabeln, verbunden werden, ist klar.
Wissenschaftlich zu formulieren, erfordert ein gewisses Maß an Formalität.
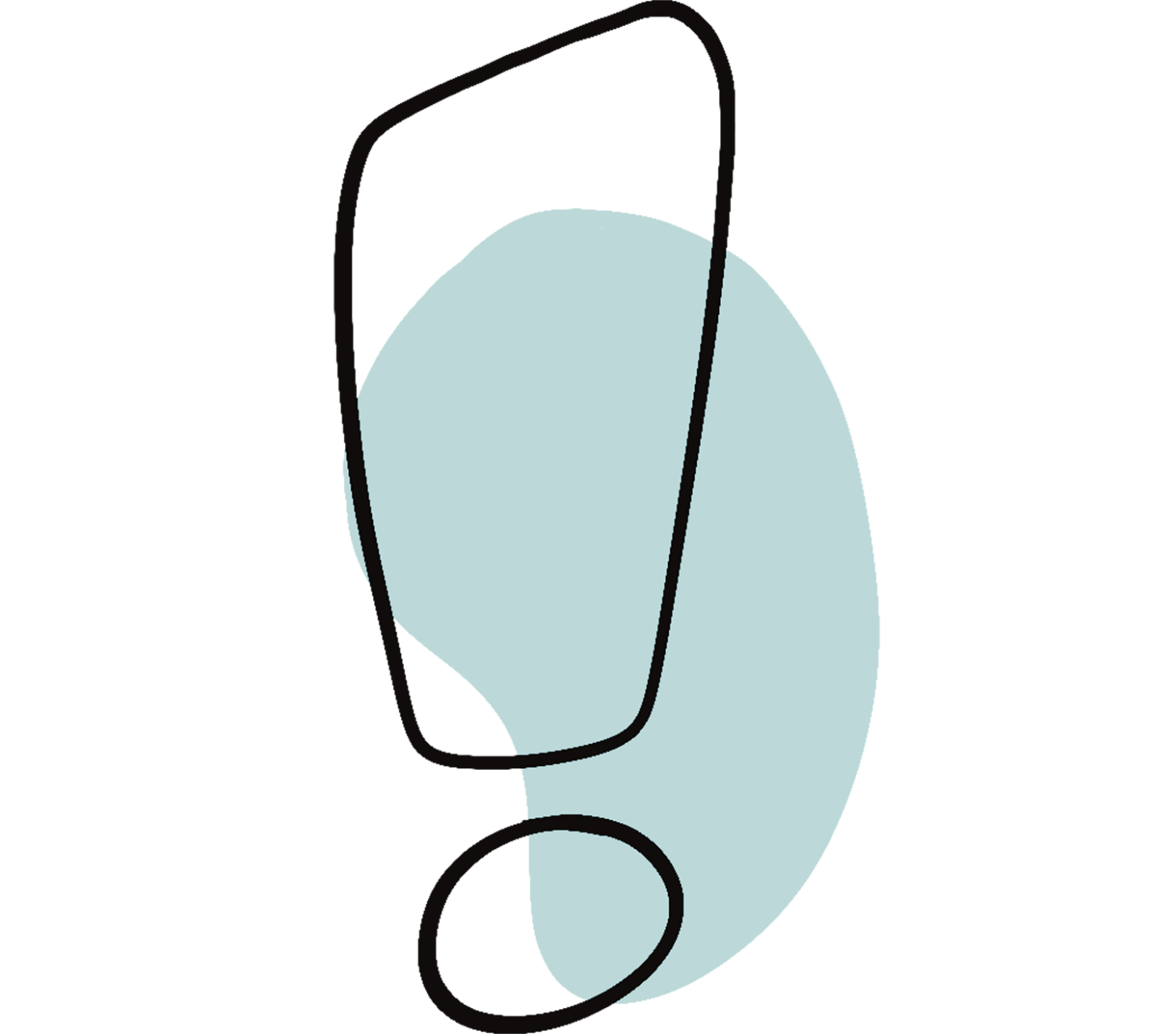
Beispiel 1:
Negativbeispiel: „Die Untersuchung wurde teilweise mit Hilfe des PTS Visums erstellt: „Das PTS Visum ist die weltweit führende Software für Verkehrsanalysen, Verkehrsprognosen und eine GIS-orientierte Datenverwaltung. Sie bildet alle Verkehrsteilnehmenden und ihre Interaktion konsistent ab, und gilt als Standard für jede Fragestellung der Verkehrsplanung. Verkaufsingenieurinnen und -ingenieure setzen PTS Visum für die Modellierung von Verkehrsnetzen und der Verkehrsnachfrage ein, sowie zur Analyse der zu erwarteten Verkehrsströme, zur ÖV-Angebotsplanung, und zur Entwicklung von anspruchsvollen Verkehrsstrategien und -lösungen.““
Formuliere das Wesentliche in eigenen, sachlichen Worten, anstatt in langen (direkten oder indirekten) Zitaten den Werbetext des Herstellers zu übernehmen:
„Die Untersuchung wurde teilweise mit PTS Visum erstellt. PTS-Visum ist die Standard-Software für Verkehrsanalysen, Verkehrsprognosen und GIS-orientierte Datenverwaltung. Sie bildet Verkehrsteilnehmende und Interaktionen ab, und lässt sich daher unter anderem für die Modellierung von Verkehrsnetzen einsetzen.“
Beispiel 2:
Negativbeispiel: „Im Brennfleck herrscht eine hohe Energiekonzentration.“
Verwende die korrekte Fachterminologie:
„Im Brennfleck herrscht eine hohe Strahlungsintensität.“
Beispiel 3:
Negativbeispiel: „Die Verfahren der Materialanalyse umfassten eine Erbringung der Nachweise über Anforderungen an den Neuentwicklungen.“
Formal bedeutet nicht: unnötig kompliziert. Substantiviere nicht öfter als nötig, es macht den Text oft schwer verständlich: z. B. „musste nun nachgewiesen werden“ statt „umfassten eine Erbringung der Nachweise“:
„Mit den Verfahren der Materialanalyse musste nun nachgewiesen werden, dass die Neuentwicklungen den Anforderungen entsprachen.“
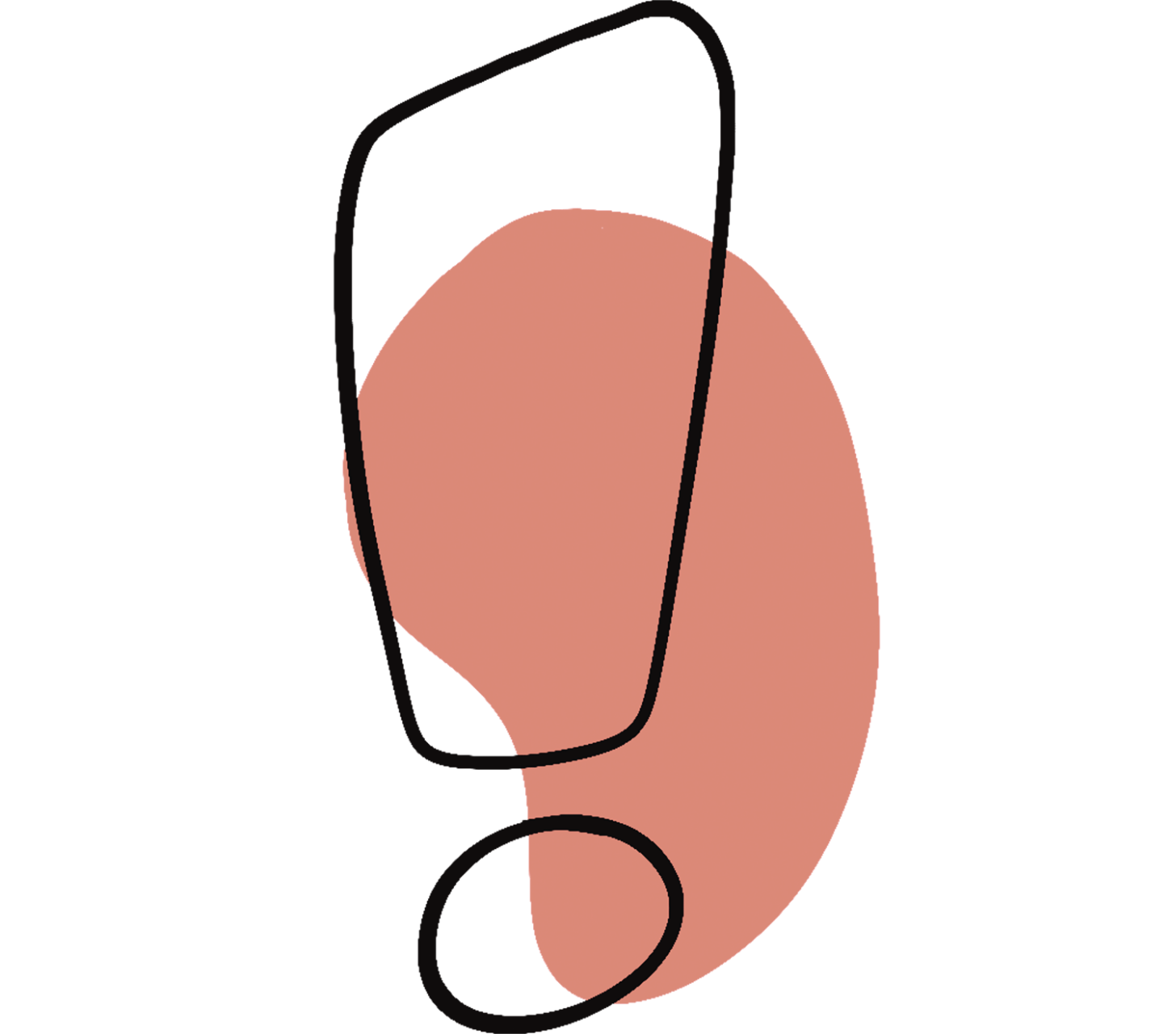
Nutze Software zur Rechtschreibprüfung, prüfe die Arbeit selbst sorgfältig, und lasse deine Arbeit vor der Abgabe möglichst von mehreren Personen Korrektur lesen, z. B. von Mitstudierenden oder Freundinnen und Freunden.

In wissenschaftlichen Arbeiten wird allgemein Gültiges im Präsens geschrieben: z. B. „… die HPLC ist eine Trenntechnik für die Analyse komplexer Proben …“
Konkrete Ergebnisse, sowohl aus der Literatur, als auch eigene, werden in der Vergangenheit geschrieben: z. B. „… Huber et al. konnten zeigen, dass eine Pufferkonzentration von 5 mM die Auflösung um 30 % verbesserte …“
Auch die Diskussion wird prinzipiell in der Vergangenheitsform formuliert, kann aber ggf. davon abweichen:
z. B. „… durch das höhere Injektionsvolumen konnte die Bestimmungsgrenze auf 5 mg/L gesenkt werden und liegt damit im Bereich der Methode von Huber et al.“
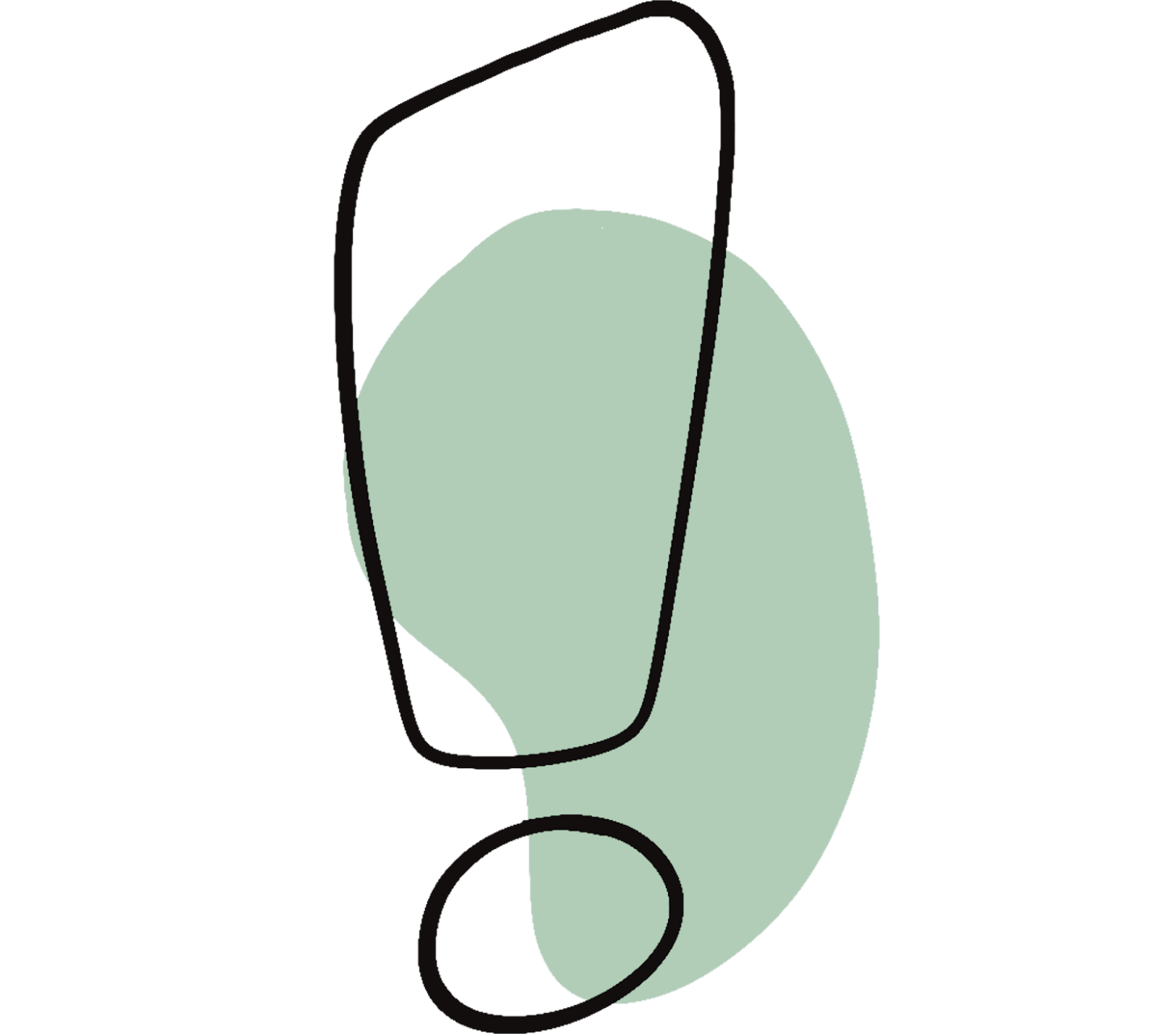
Nutze nicht die Zukunftsform, um auszudrücken, was in deiner Arbeit noch folgen „wird“. Deine Arbeit ist zum Zeitpunkt des Lesens schon geschrieben, und die dargestellte Untersuchung abgeschlossen. Lediglich bei der Darstellung konkreter einmaliger Tätigkeiten bzw. Untersuchungen ist es vor allem in den Naturwissenschaften üblich, dies in der Vergangenheitsform abzufassen.
Was fällt unter den Begriff „formal“?
Formal bedeutet einerseits, nicht unnötig kompliziert zu schreiben (also mit wenig Substantivierungen), aber auch, dass die Rechtschreibung und Interpunktion korrekt sind.
Wie kann ich meine Arbeit „unpersönlich“ schreiben?
Vermeide das Pronomen „Ich“. Tipp: Häufig eignen sich Formulierungen im Passiv.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.