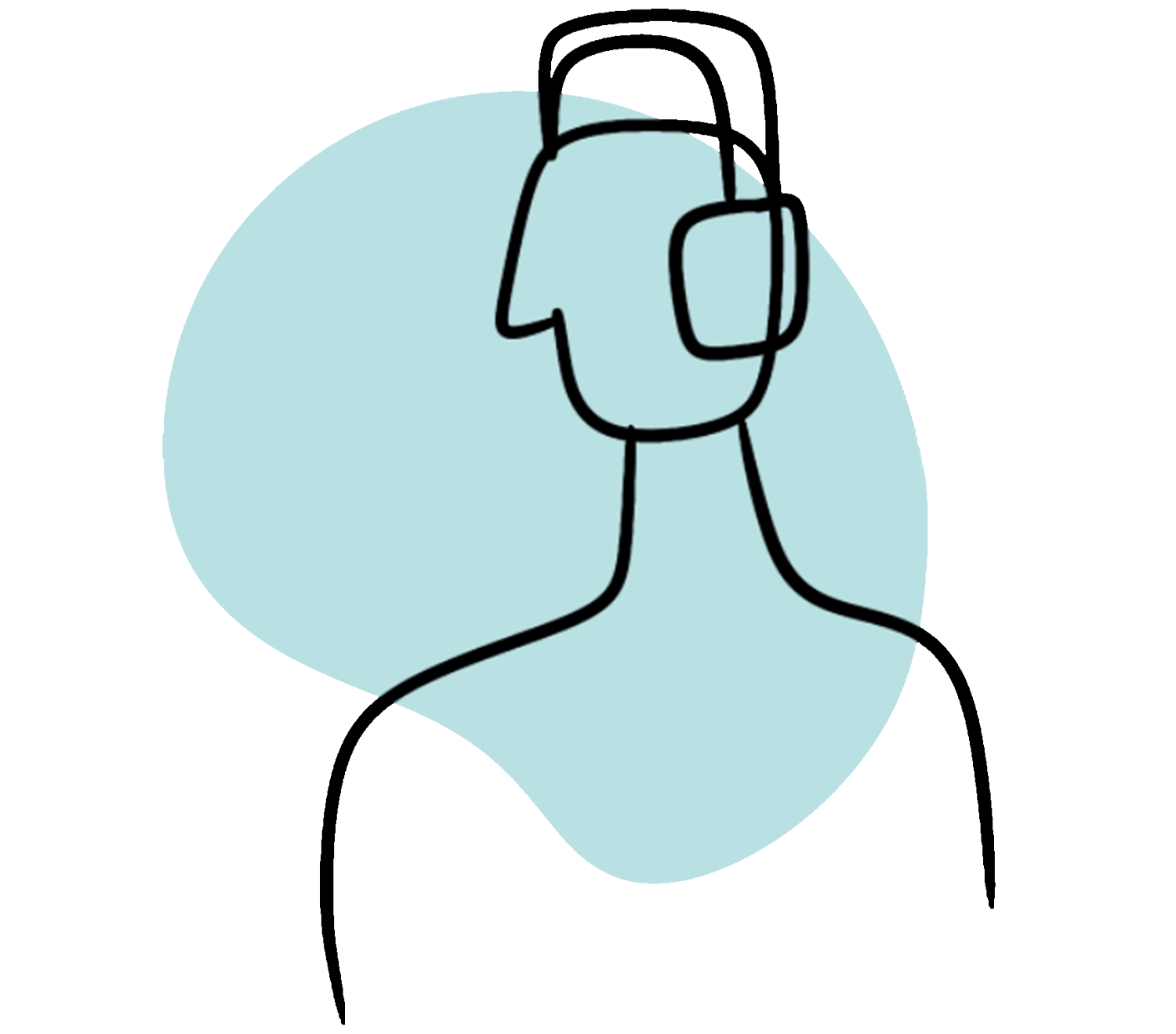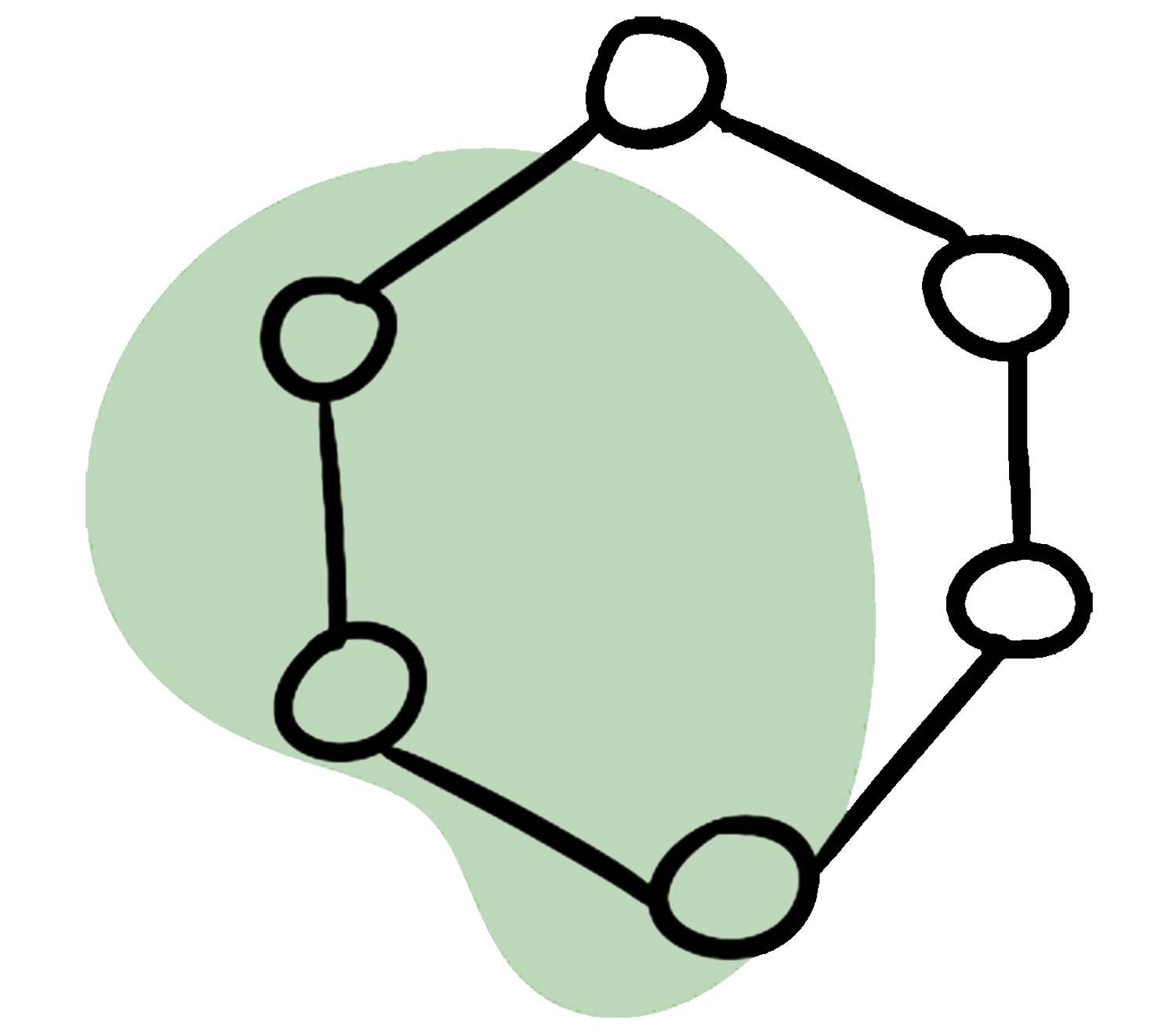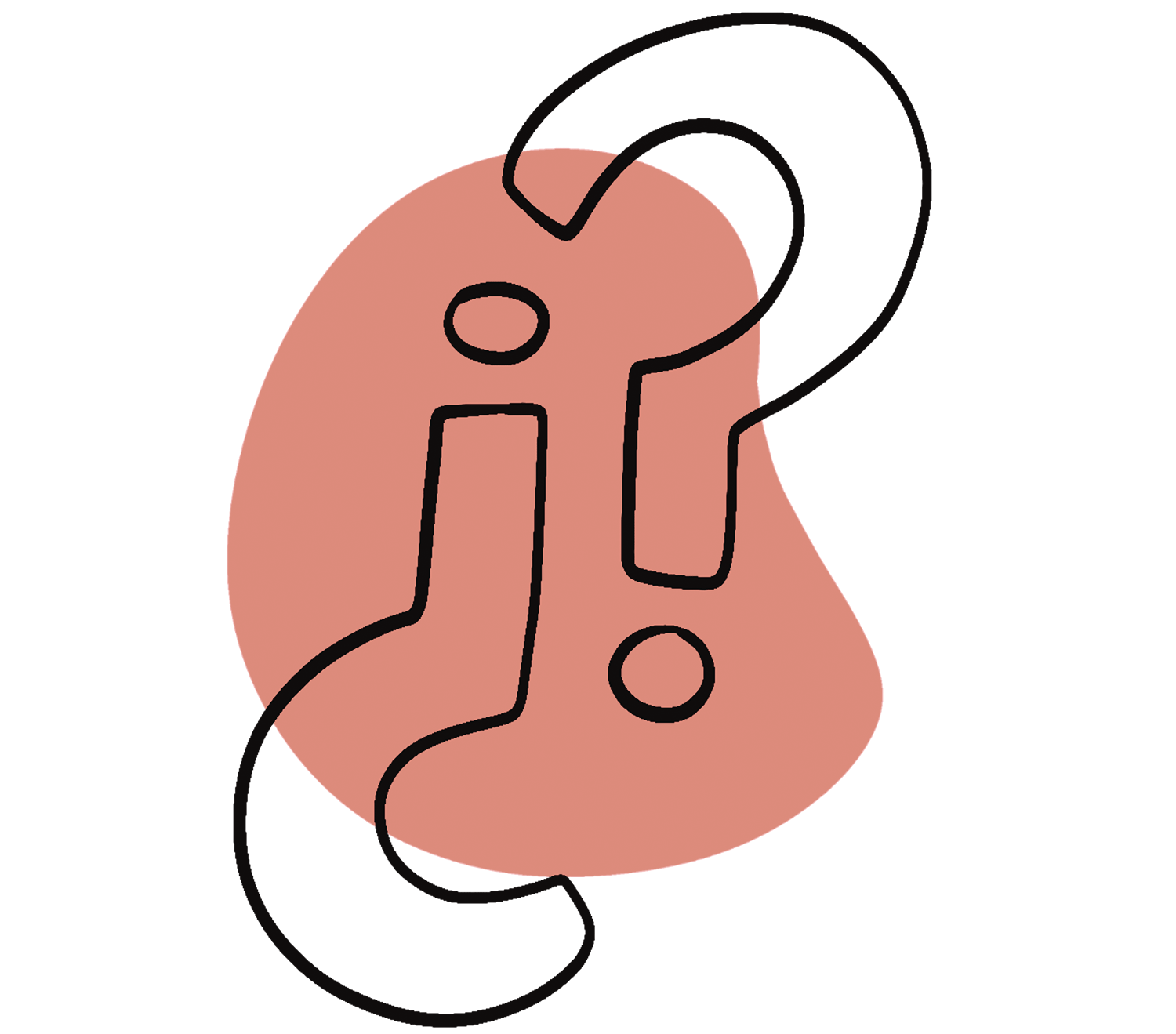Manche Forschenden der Sozialwissenschaft verwenden ganz selbstverständlich die erste Person Singular, also das „Ich“. Andere neigen eher zu unpersönlichen Satzkonstruktionen, wie z. B.: „Im vorliegenden Aufsatz wird die Frage erörtert, ob …“. Manche sprechen von sich selbst in der dritten Person als „die Autorin“ oder „der Verfasser“.

Was als „wissenschaftliches Schreiben“ gilt, lässt sich nicht – von wem auch immer – per Dekret anordnen, sondern ist ständig „im Fluss“ und abhängig von der jeweiligen Bezugsgruppe von Kolleg*innen, die „so etwas“ akzeptieren oder die Stirn runzeln.
– Gerhard Riemann
Sehr persönlich gehaltene Texte, z. B. im Stil der Autoethnographie, die tiefe Einblicke in eigene Erfahrungen und Befindlichkeiten eröffnen und die Lesenden z. T. irritieren oder gar verstören, wären vor einiger Zeit im Kontext sozialwissenschaftlicher Zeitschriften noch nicht vorstellbar gewesen.
Es geht auch nicht nur darum, ob Autorinnen und Autoren das Wort „ich“ verwenden oder ablehnen, sondern auch darum, was und wie viel sie von sich preisgeben.
Wenn es um die Rekonstruktion und Diskussion von eigenen Feldforschungserfahrungen geht, kann es gerade wichtig sein und zu neuen Erkenntnissen führen, wenn man in persönlichen Worten festhält, was schwierig war, Mühe bereitet hat und als chaotisch erlebt wurde. Und da liegt es näher, zu schreiben: „Ich wurde nervös, und fing an zu stottern, als die Klientin nachhakte.“ anstatt „Die Autorin dieses Berichts zeigte Anzeichen von Nervosität und hatte Wortfindungsschwierigkeiten, als die Klientin weitere Fragen stellte.“.
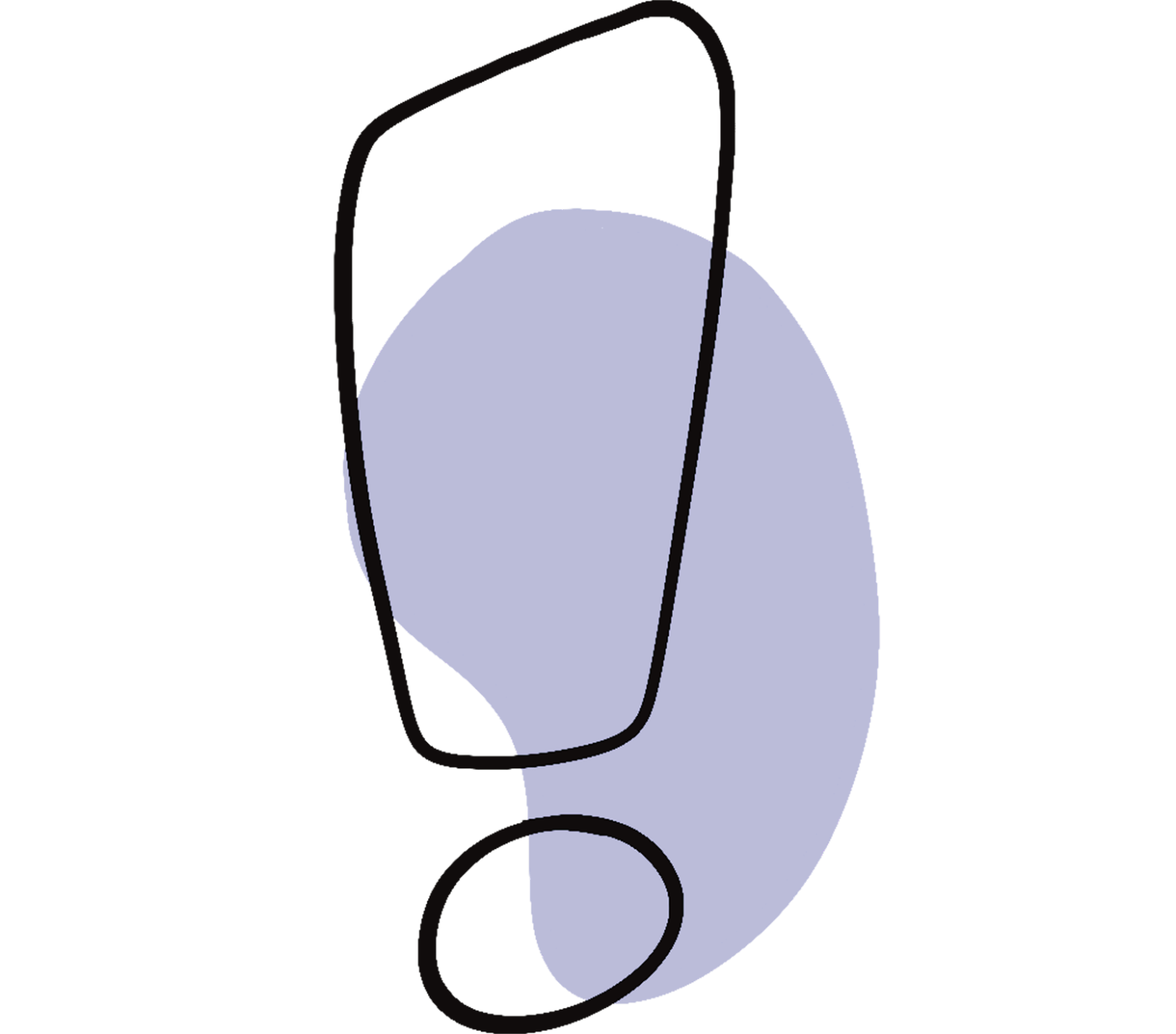
Wichtig ist zum einen, dass Studierende nicht in Ehrfurcht vor der vermeintlichen Wissenschaftssprache erstarren, sondern sich selbst einen Eindruck von der Spannbreite sozialwissenschaftlicher Texte machen, sowie von den jeweiligen sprachlichen Ausdrucks- und Gestaltungsmitteln.
Es gibt nicht die eine Sprachregelung. Um nicht in diese Ehrfurcht zu geraten und sich entmündigen zu lassen, hilft es, dass man selbst sozialwissenschaftliche Literatur liest und sich nicht mit „prüfungsrelevanten Powerpoint-Folien“ zufrieden gibt.

Die Lehrenden an der Fakultät SW sind in ihrer wissenschaftlichen Sozialisation sehr unterschiedlich geprägt worden, und das ist auch gut so.

Auf keinen Fall sollten Studierende das falsche Selbstverständnis kultivieren, ihnen stehe eine bestimmte Art des Schreibens nicht zu, weil sie ja erst Studierende oder bloß angehende Sozialpädagog*innen seien. Sie können sich ihres Kopfes genauso bedienen wie Dozent*innen.
– Gerhard Riemann
Wirkt das Wort „ich“ in meiner wissenschaftlichen Arbeit unprofessionell?
Kontext und Absicht sind hierbei entscheidend: Ein selbstreflexiver ethnographischer Bericht, in dem man sich mit eigenen Praxis- oder Feldforschungserfahrungen beschäftigt und diese transparent machen will, ist etwas anderes als eine Literaturdiskussion oder ein Forschungsantrag.
Wie finde ich die richtige Wissenschaftssprache für meine wissenschaftliche Arbeit?
Es gibt nicht die eine richtige Wissenschaftssprache, sondern innerhalb des Feldes eine dynamische Spannbreite an Möglichkeiten. Halte am Besten Rücksprache mit deinen Lehrenden und Betreuenden, um unterschiedliche Stile durchzusprechen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im Oktober 2024 und zuletzt aktualisiert im Oktober 2024.