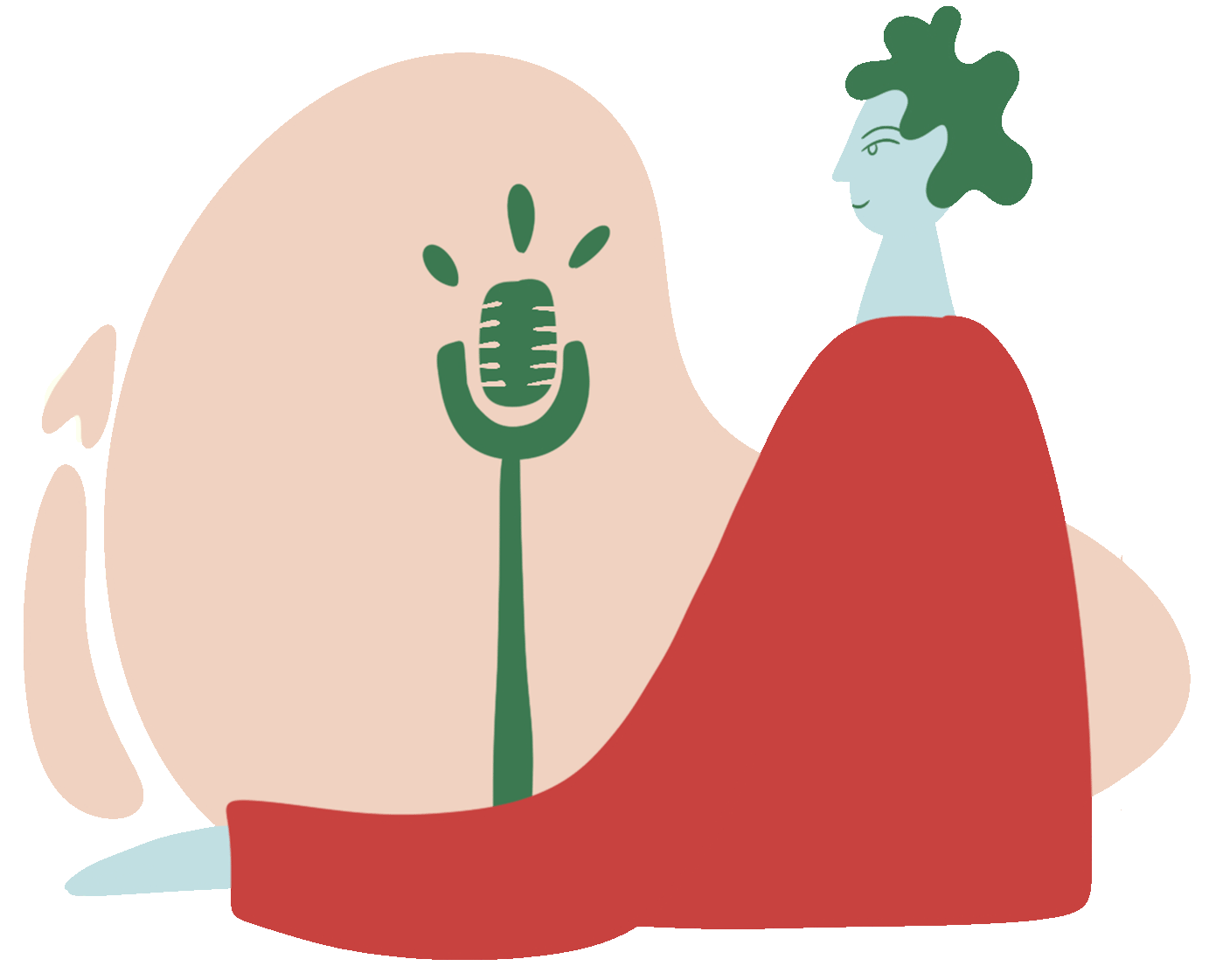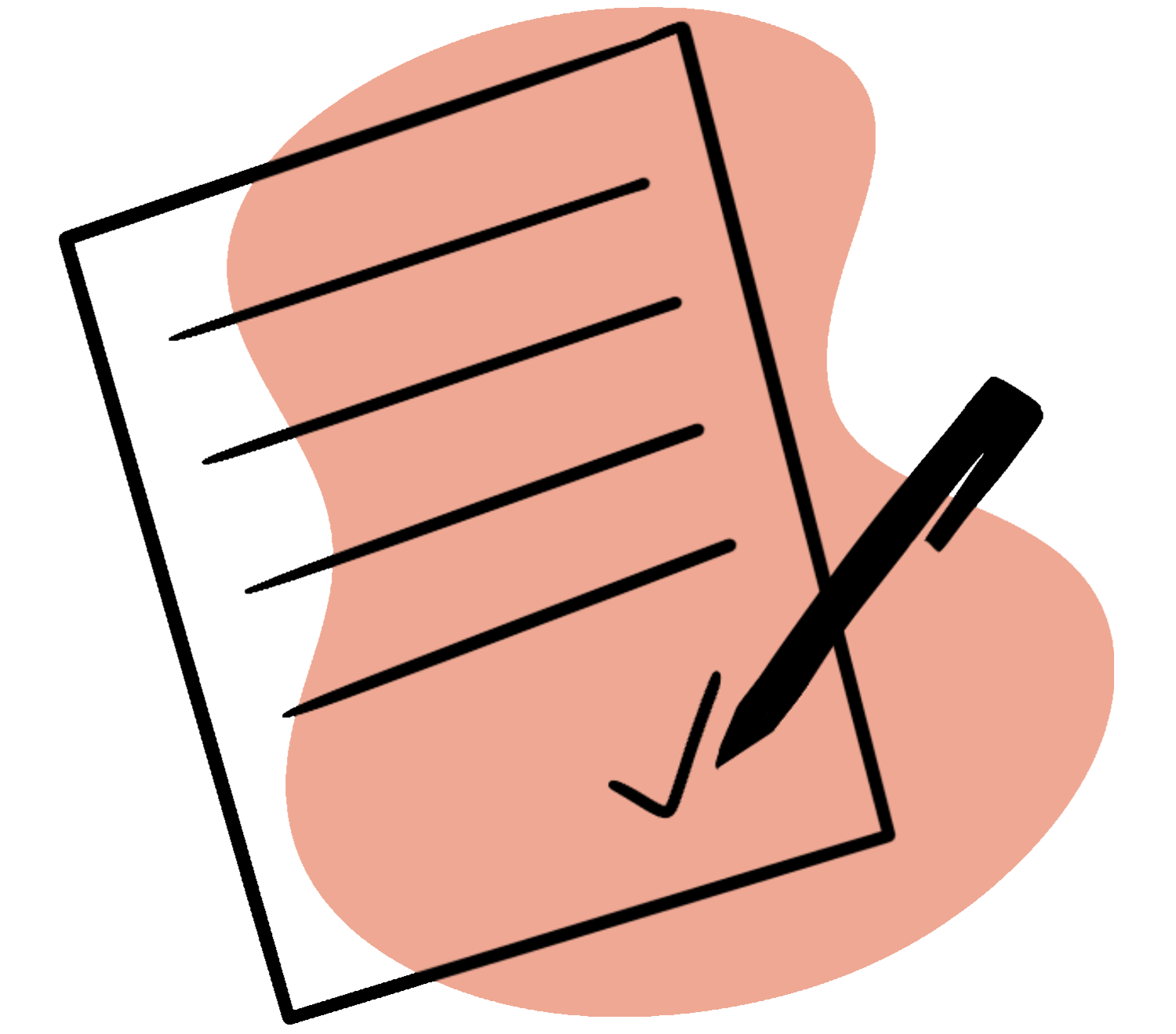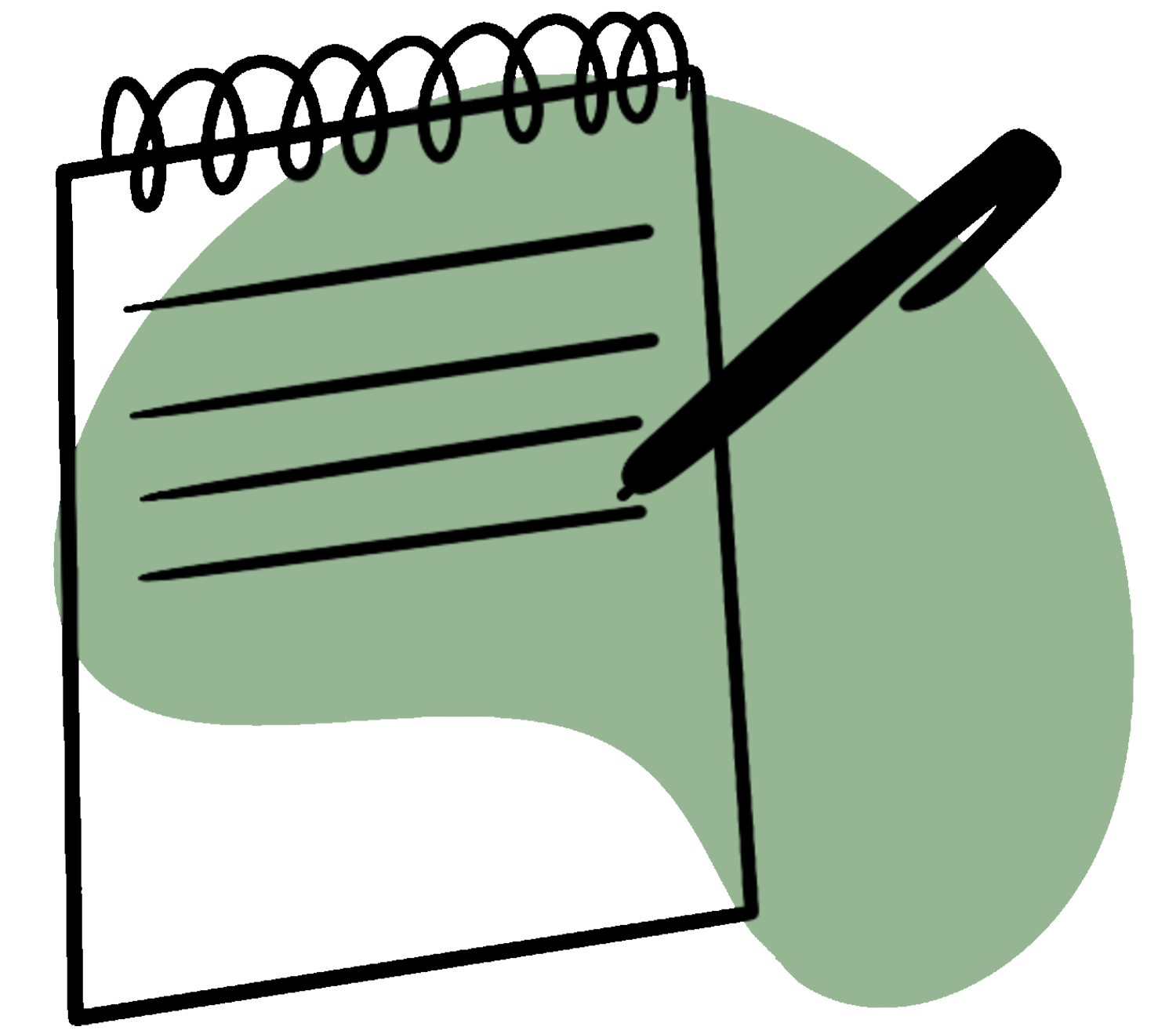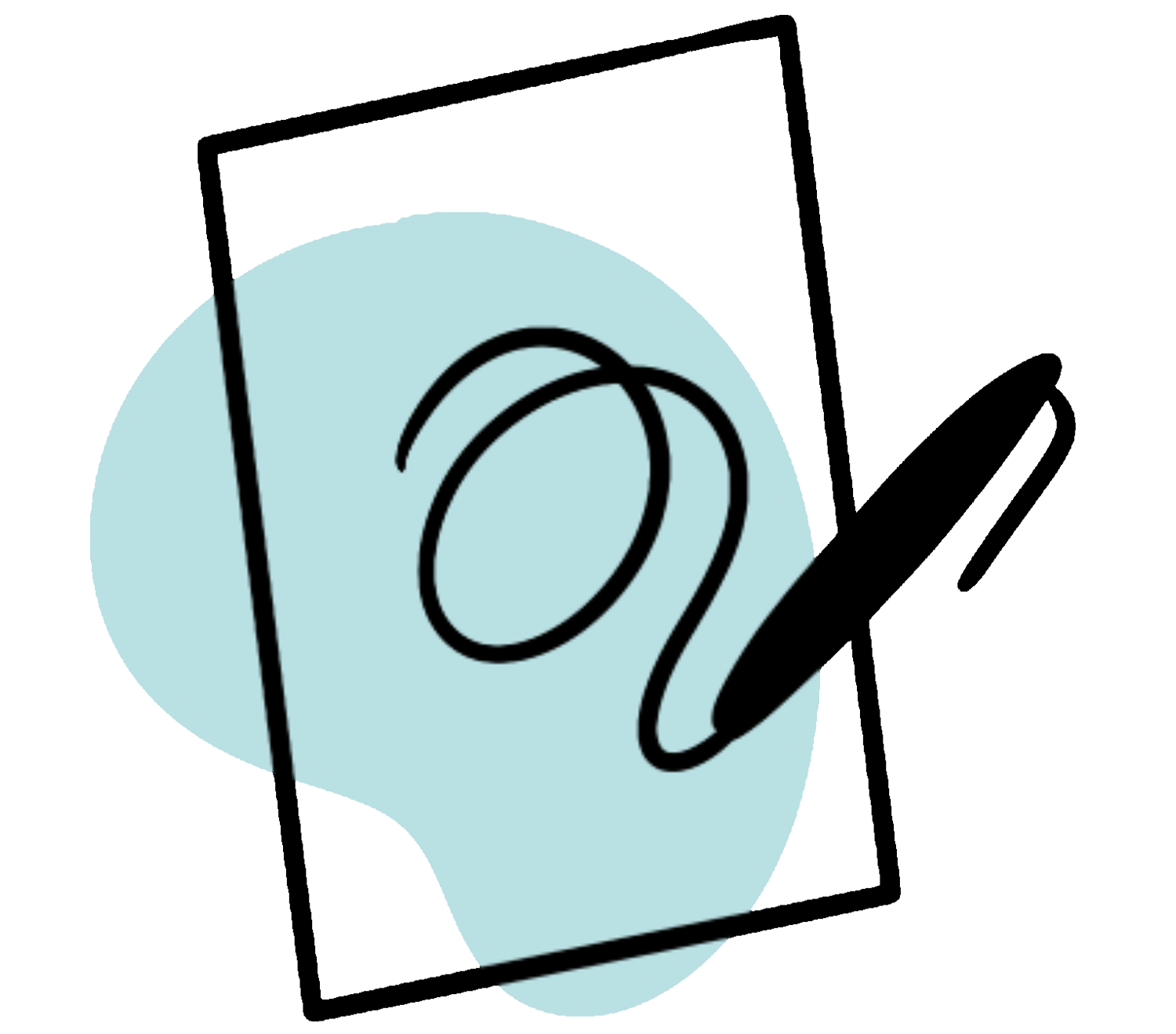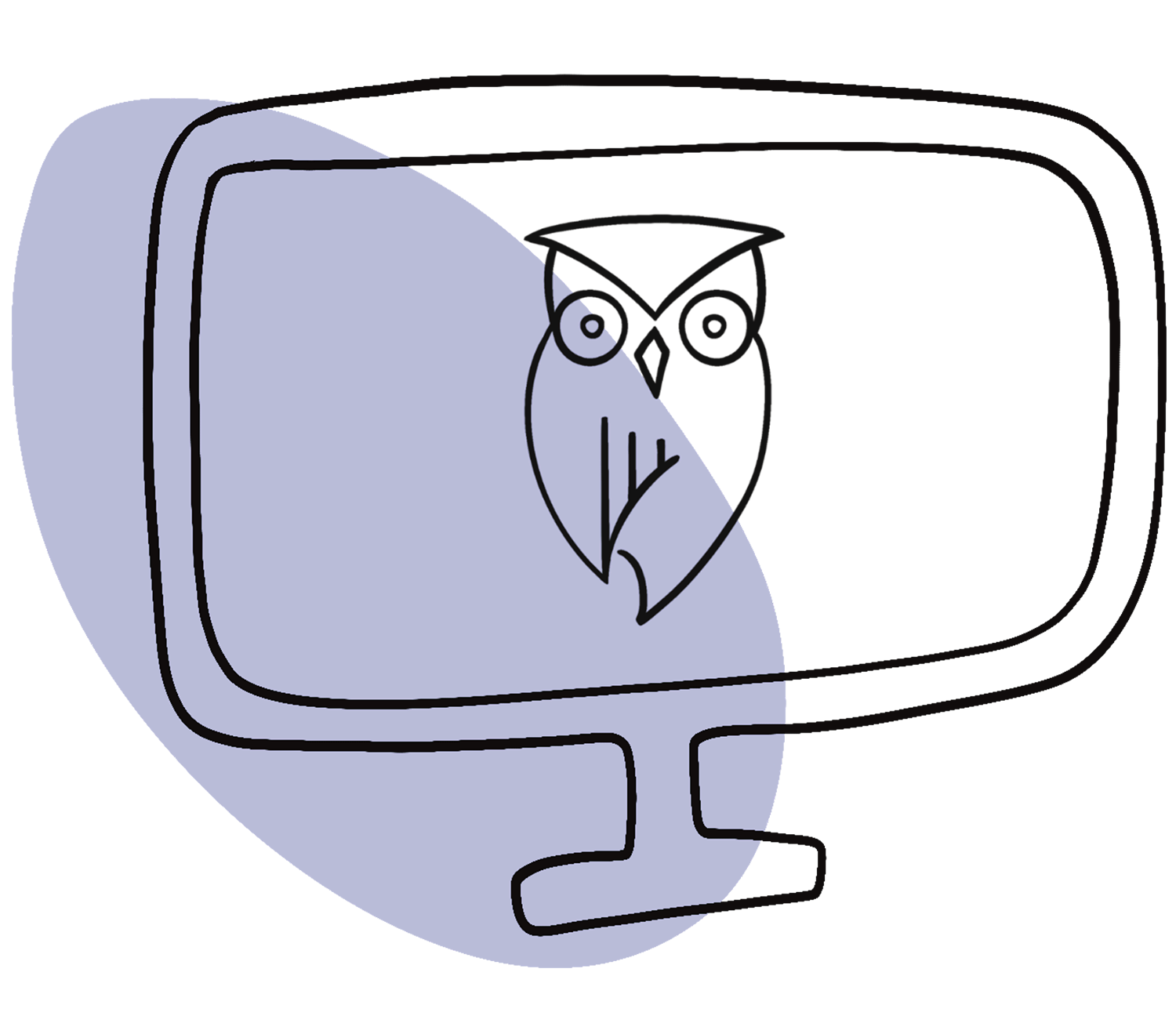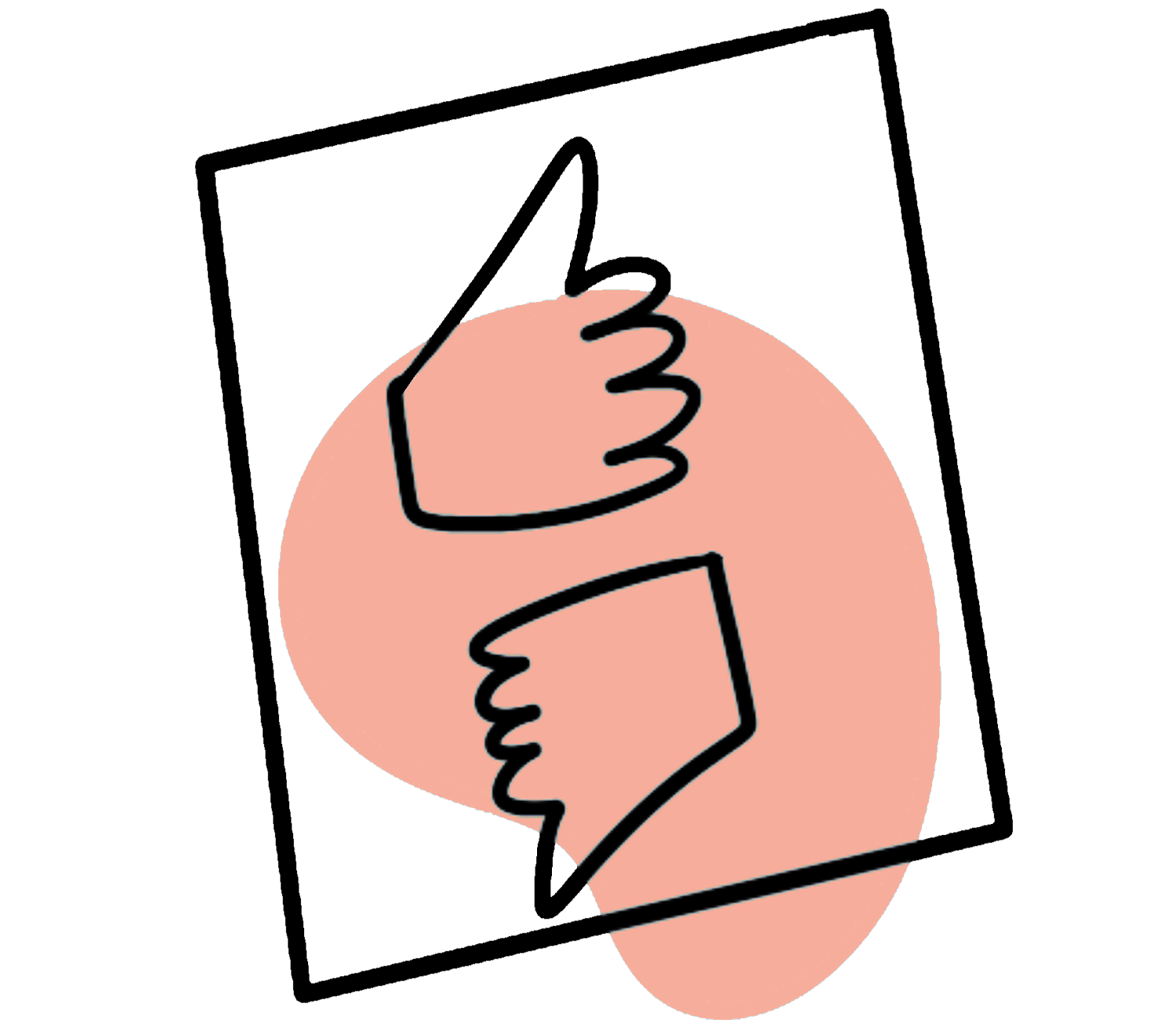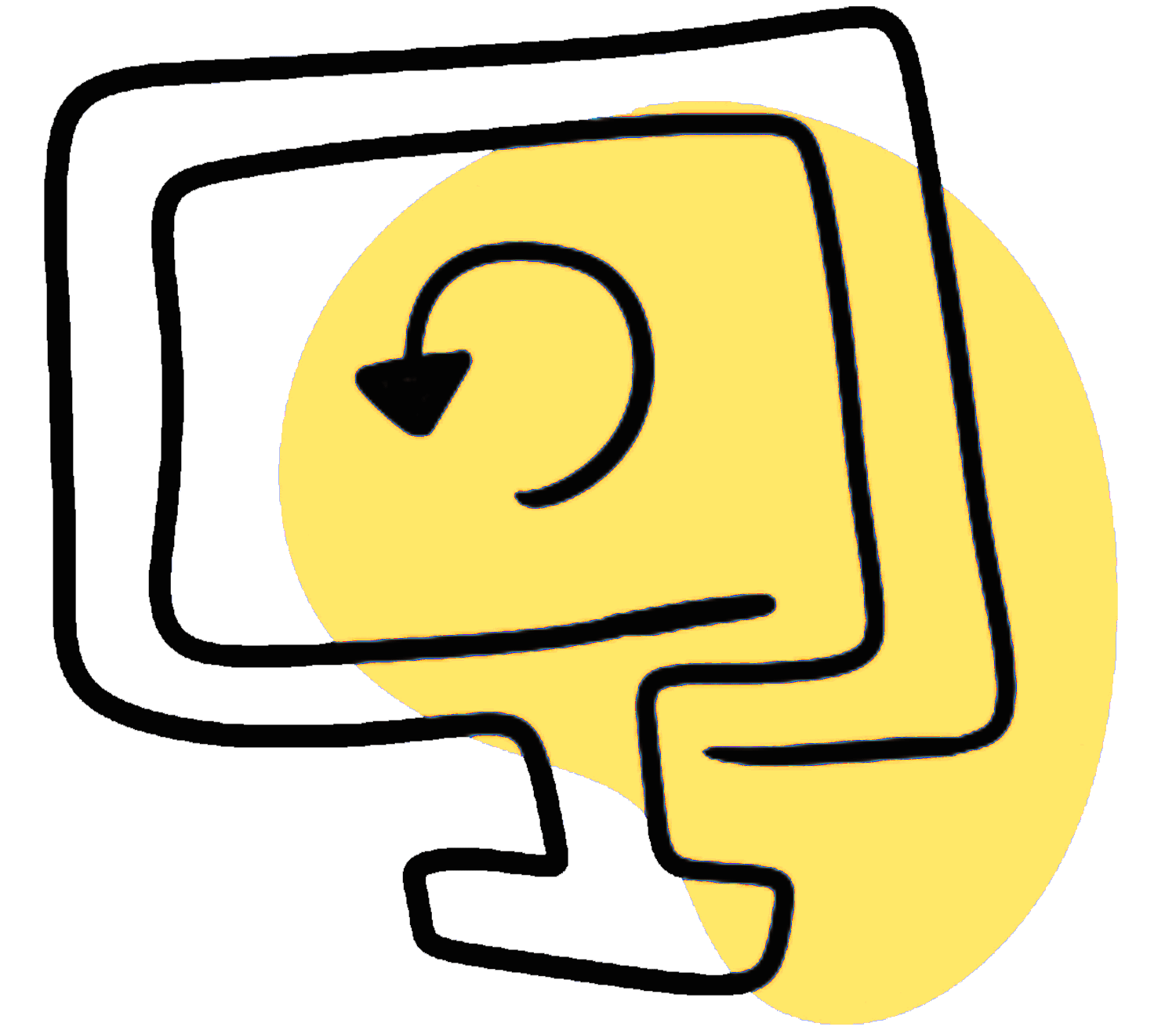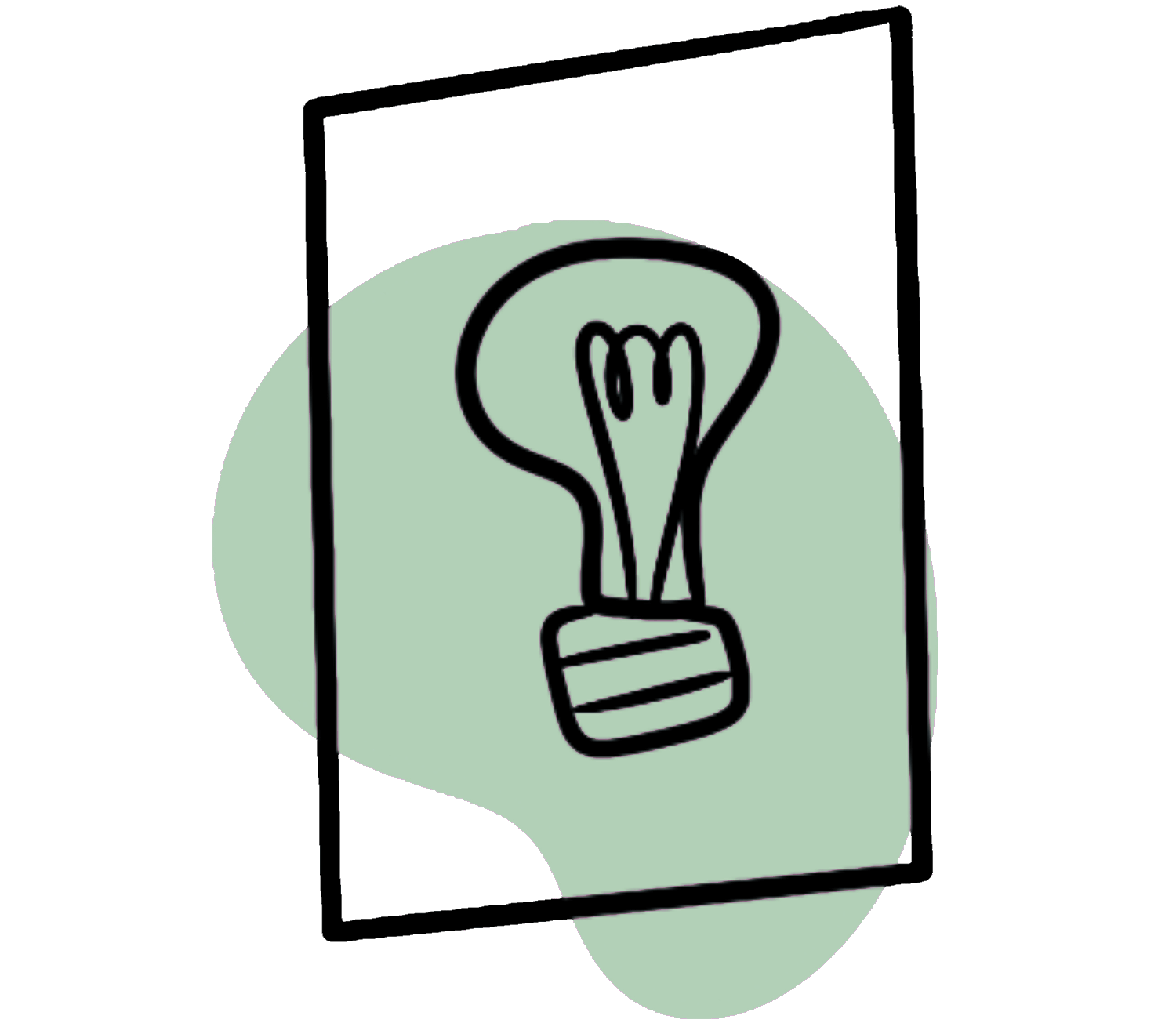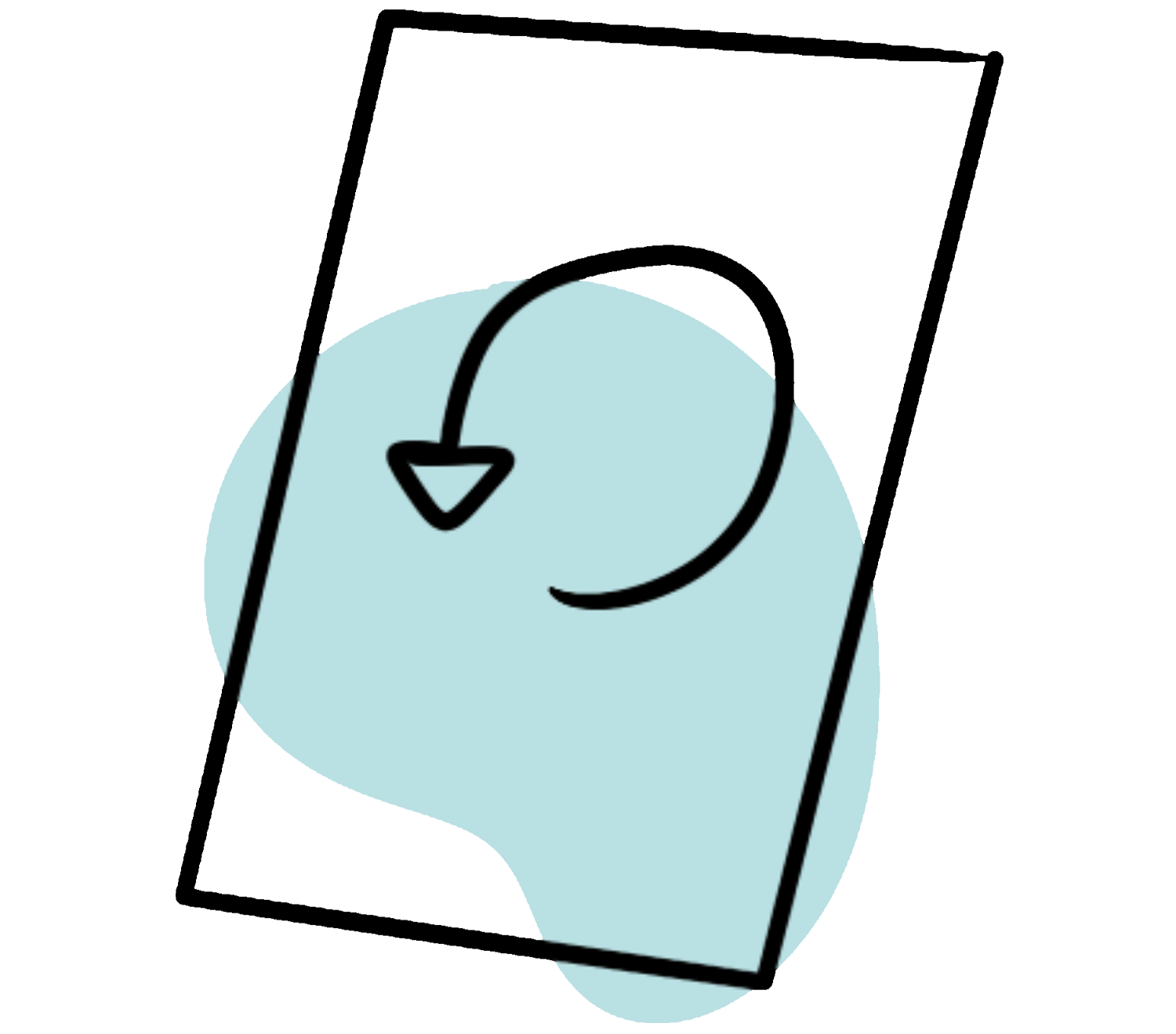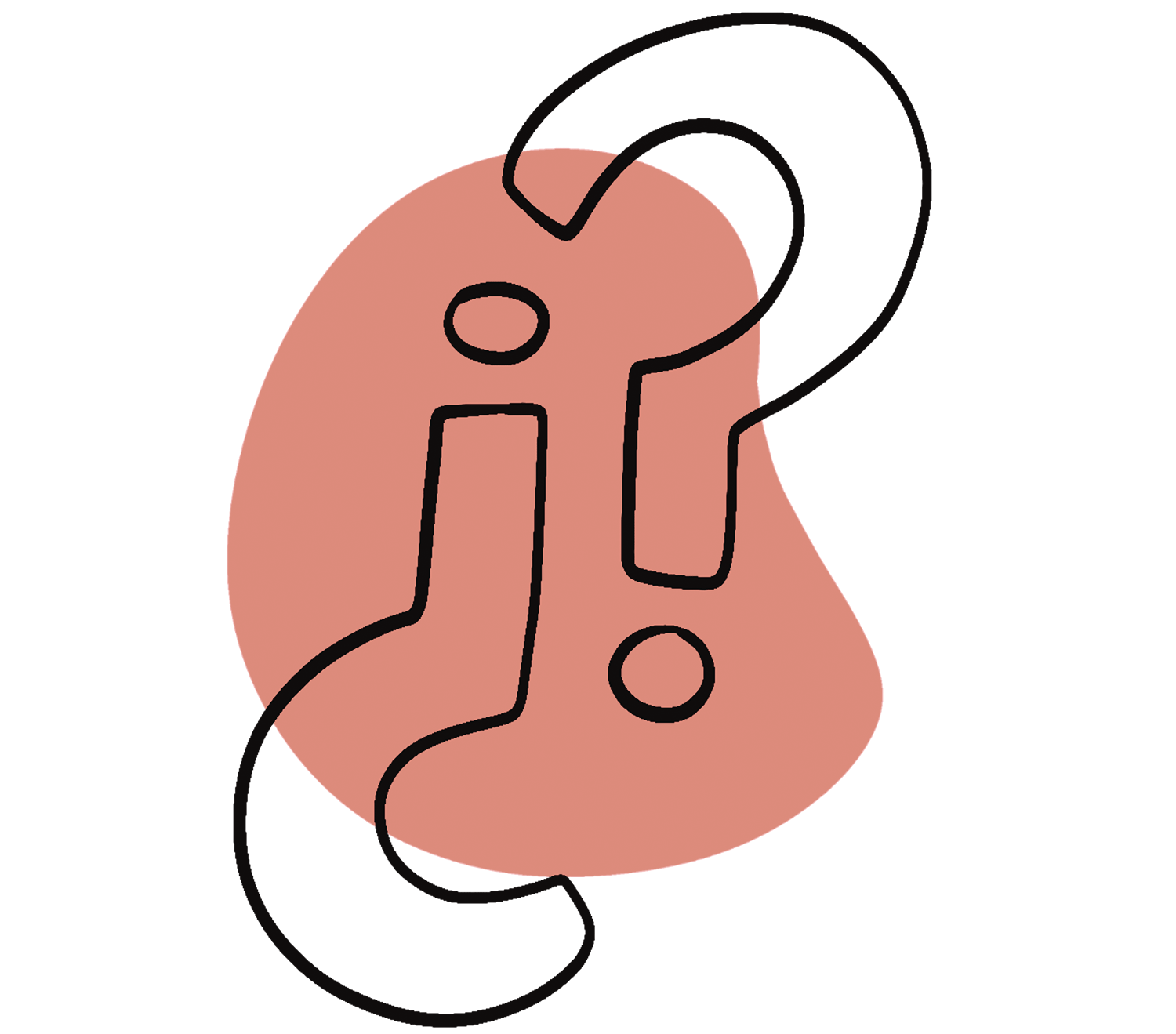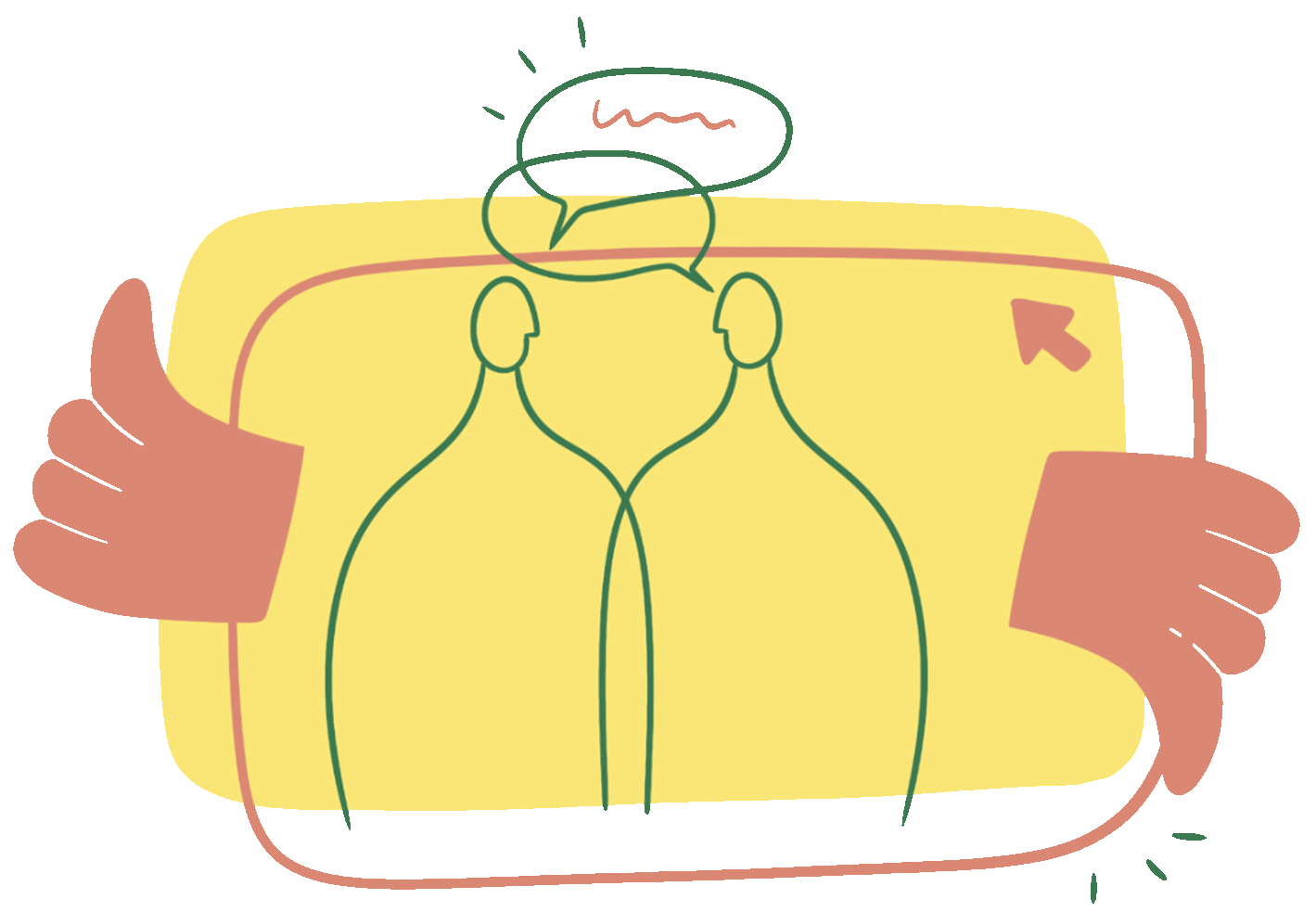Das Komma ist ein Gliederungszeichen, das innerhalb eines Satzes bestimmte Wörter voneinander trennt, wie bei einer Aufzählung und Wortgruppen, oder Nebensätze sowie auch Hauptsätze voneinander trennt. Eine gezielte Kommasetzung gibt Sätzen ihre sinngemäße Struktur und erleichtert das Lesen, indem sie den Lesenden kleine Atempausen gibt.

Beispiel: „Petra erbte den Schmuck nicht aber ihr Mann.“
Mögliche Interpretationen:
- „Petra erbte den Schmuck, nicht aber ihr Mann.“
- „Petra erbte den Schmuck nicht, aber ihr Mann.“
Bei Satzteilen mit gleicher syntaktischer Funktion wird entweder durch Konjunktion oder Komma getrennt.
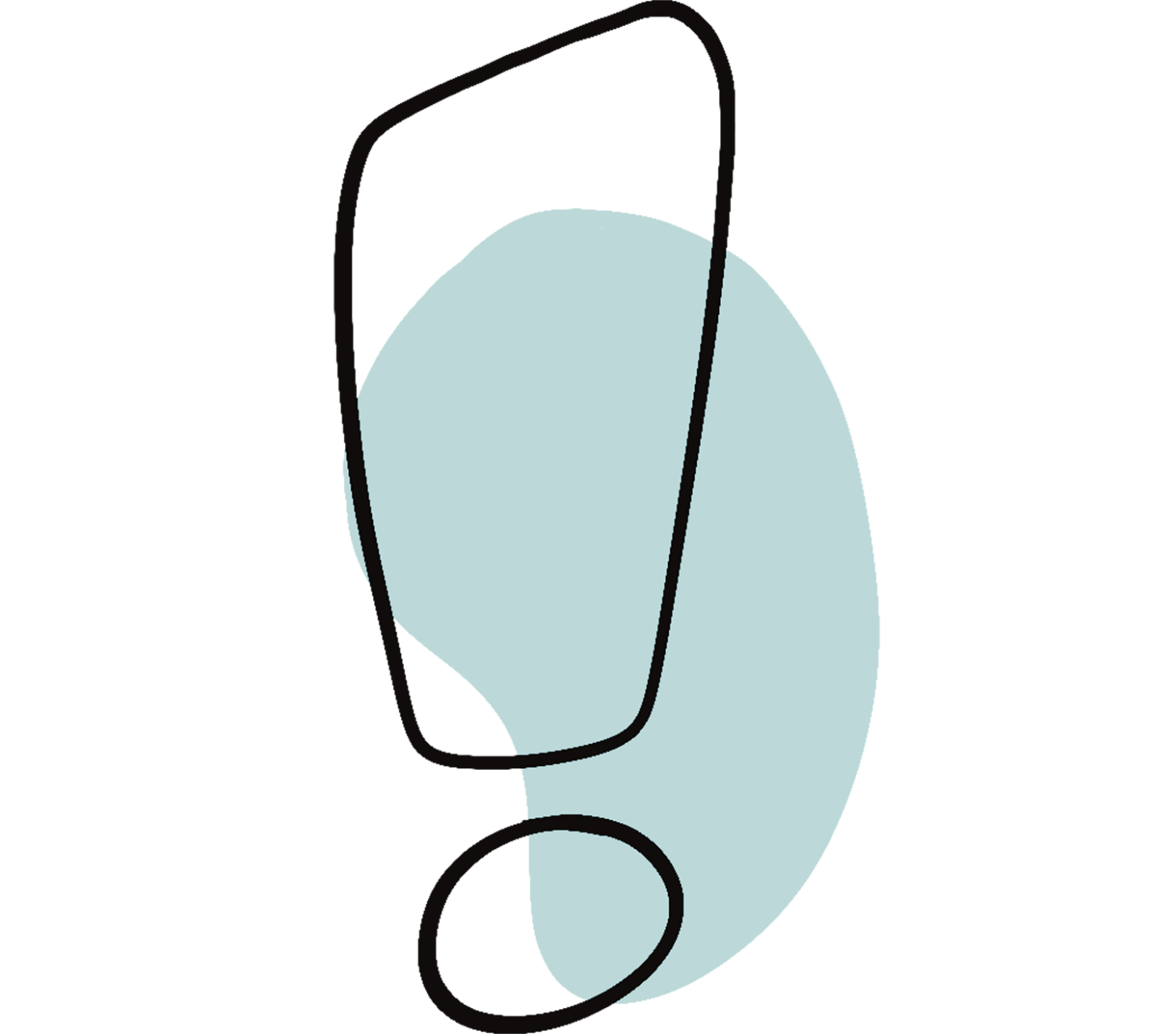
Beispiel mit Konjunktion: „Wir besitzen einen Hund und eine Katze und eine Maus und einen Vogel.“
Beispiel mit Komma: „Wir besitzen einen Hund, eine Katze, eine Maus und einen Vogel.“
Du kannst vor einer Aufzählung auch sehr gut Doppelpunkte nutzen.
Das Komma steht immer zwischen aufzählenden Satzteilen, die durch Konjunktionen verbunden sind. Bei bestimmten Konjunktionen und Adverbien steht immer ein Komma.
Beispiele: „einerseits …, andererseits …“, „zum einen …, zum anderen …“, „je …, desto …“, „teils …, teils …“, „zwar …, aber …“
Gelten die aufzählenden Wörter jedoch als gleichrangig, müssen Kommata nicht unbedingt gesetzt werden.
Beispiele: „und“, „oder“, „sowie“, „sowohl … als auch …“, „entweder … oder …“, „weder … noch …“
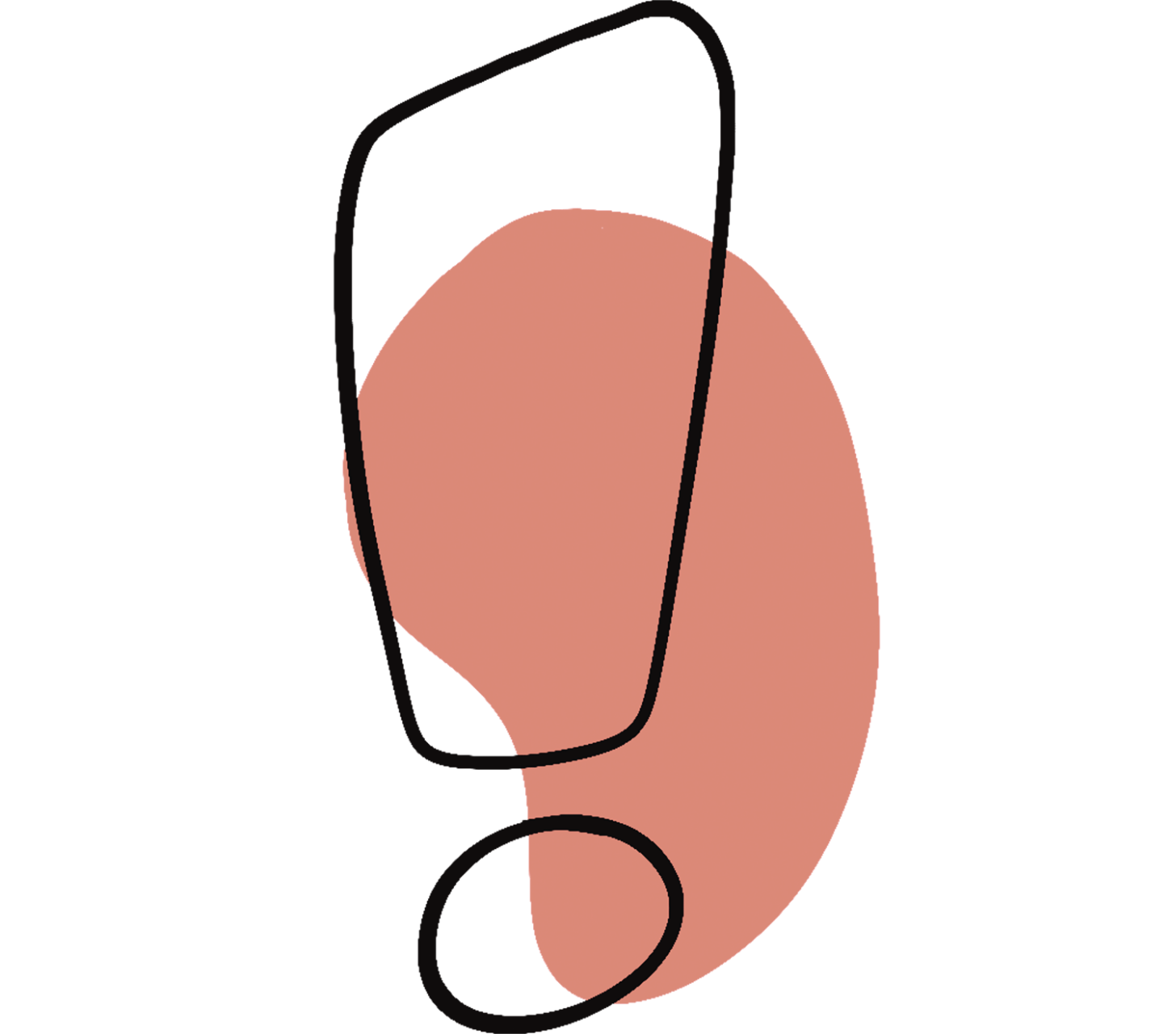
Beispiel: „Du kannst dich entscheiden, heute Abend entweder ins Kino zu gehen und den neuen Film zu sehen, auf den du dich schon so lange gefreut hast(,) oder du bleibst zu Hause, machst es dir gemütlich und liest endlich das Buch weiter, das schon seit Wochen auf deinem Nachttisch liegt.“
Du kannst auch unabhängige und grammatikalisch vollständige Sätze – also Hauptsätze – durch Kommata zusammenfassen.
Beispiel: „Sie riss die Tür auf. Sie schrie. Sie stolperte zurück.“ wird zu „Sie riss die Tür auf, sie schrie, sie stolperte zurück.“
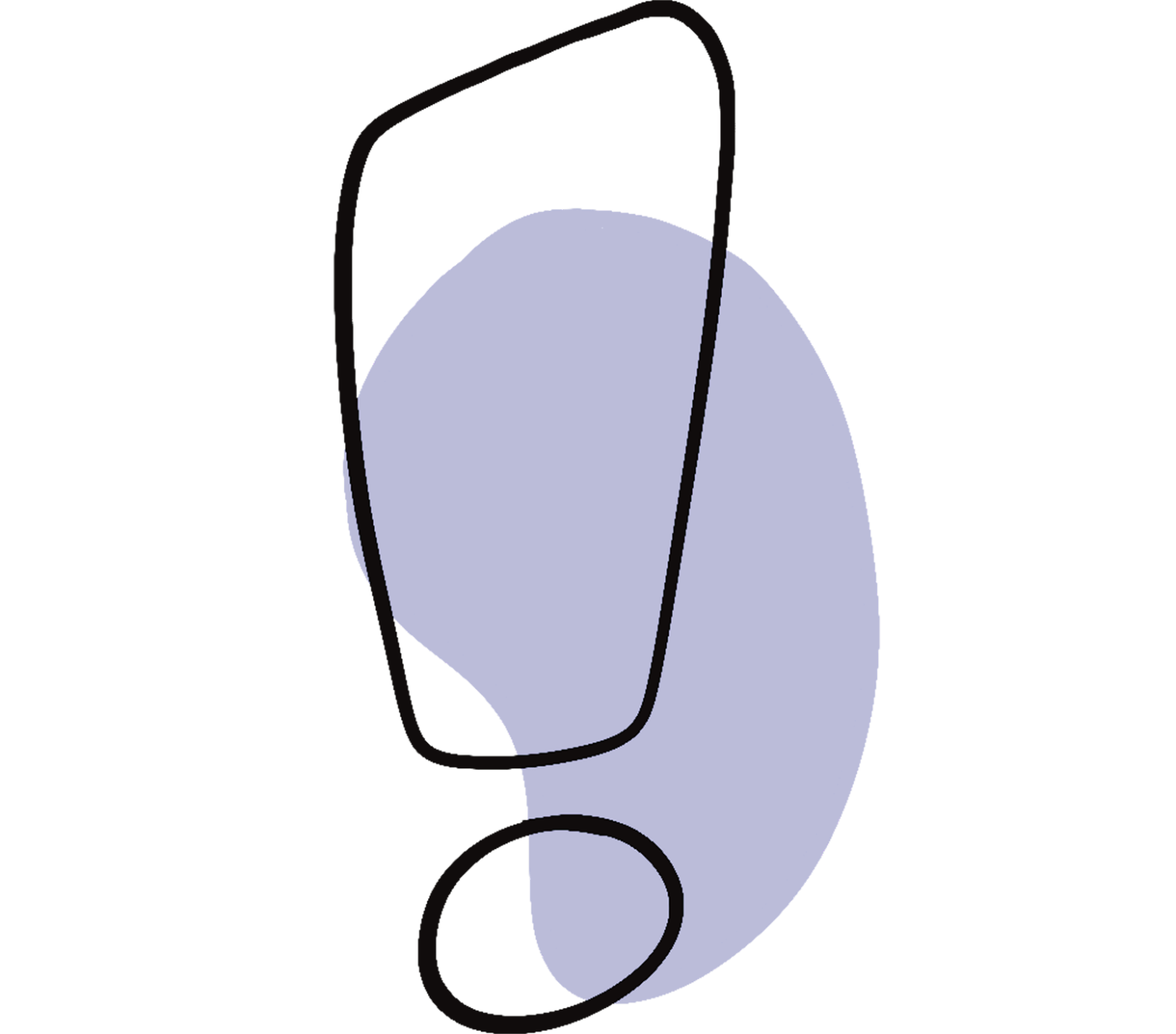
Nebensätze werden immer durch Satzzeichen getrennt. Das muss jedoch nicht immer ein Komma sein.
Beispiele:
- „Peter wusste, dass das nicht funktionieren konnte.“
- „Peter wusste: Das konnte nicht funktionieren.“
- „Das konnte nicht funktionieren – das wusste Peter.“
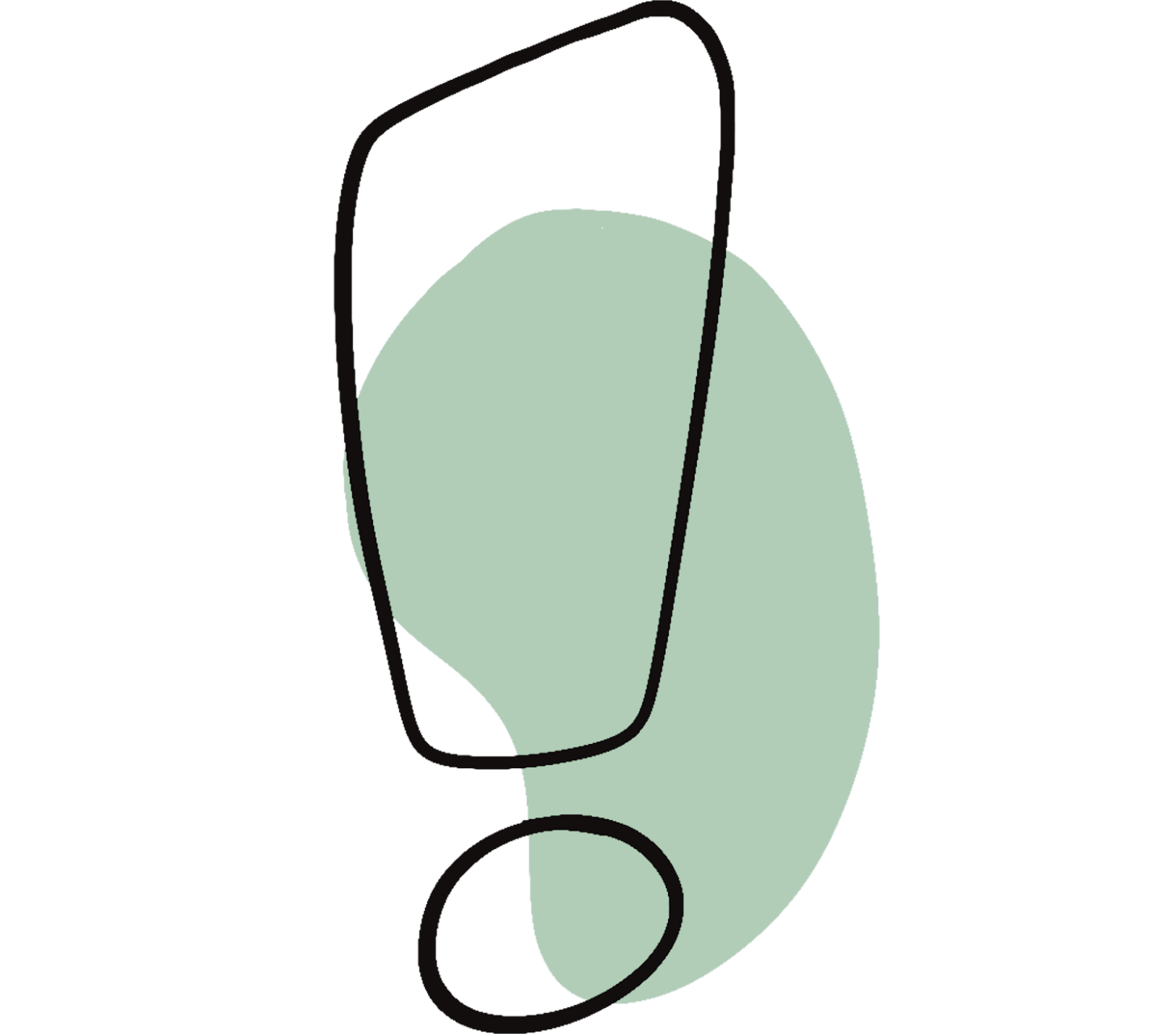
Beispiele: „da/weil“, „als“, „wenn/falls“, „während“, „nachdem“, „obwohl/obgleich“, „indem“
Appositionen sind Beisätze und werden entweder mit Kommata in den Satz eingeschoben oder nachgestellt.
Beispiele: „Der Hund, der laut bellte, rannte über die Wiese.“ oder „Der Hund rannte über die Wiese, er bellte laut.“

Das Komma trennt Vergleichssätze vom übergeordneten Satz.
Beispiele: „Sie arbeitete genau so lange, wie sie es vorgehabt hatte.“ oder „Das Zeugnis war besser, als ich geglaubt hatte.“
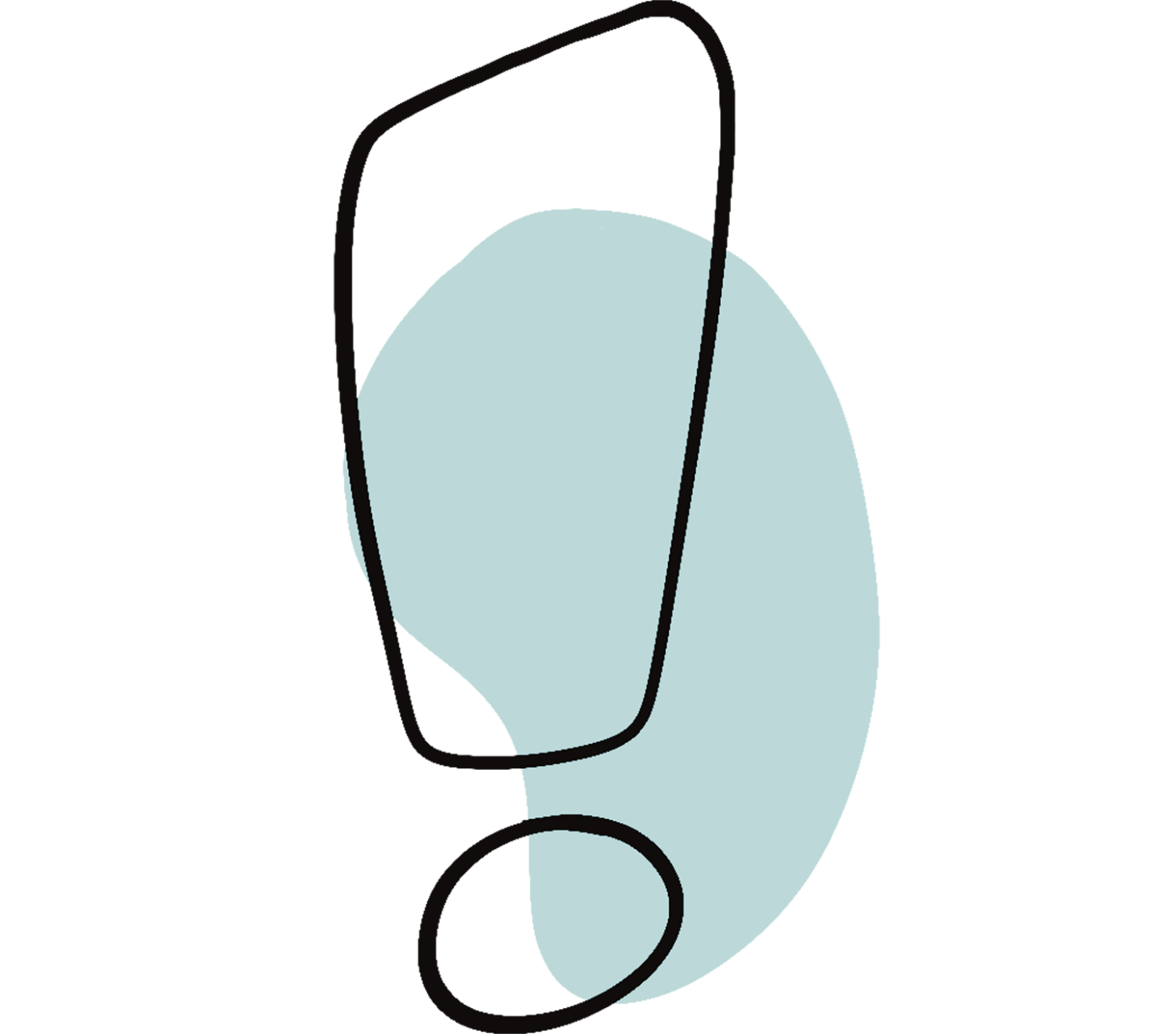
Ist der zu vergleichende Teil des Satzes nicht vollständig, entfällt das Komma.
Beispiel: „Ich bin genauso schnell wie du.“ oder „Der Hund sieht aus wie ein Labrador.“
Ein erweiterter Infinitiv ist der Teil des Satzes, der in unmittelbarem Bezug zu der „zu + Infinitiv-Konstruktion“ steht.
Beispiel: „Es wäre oberflächlich, von allen Männern zu behaupten, sie seien Fußballfans.“
Ein Komma ist immer dann unbedingt notwendig, wenn der Satz sonst nicht eindeutig ist.
Beispiel: „Uta versuchte, nicht das Lied zu singen.“ Anders: „Uta versuchte nicht, das Lied zu singen.“
Das Komma kann entfallen, wenn keine Missverständnisse beim Lesen entstehen.
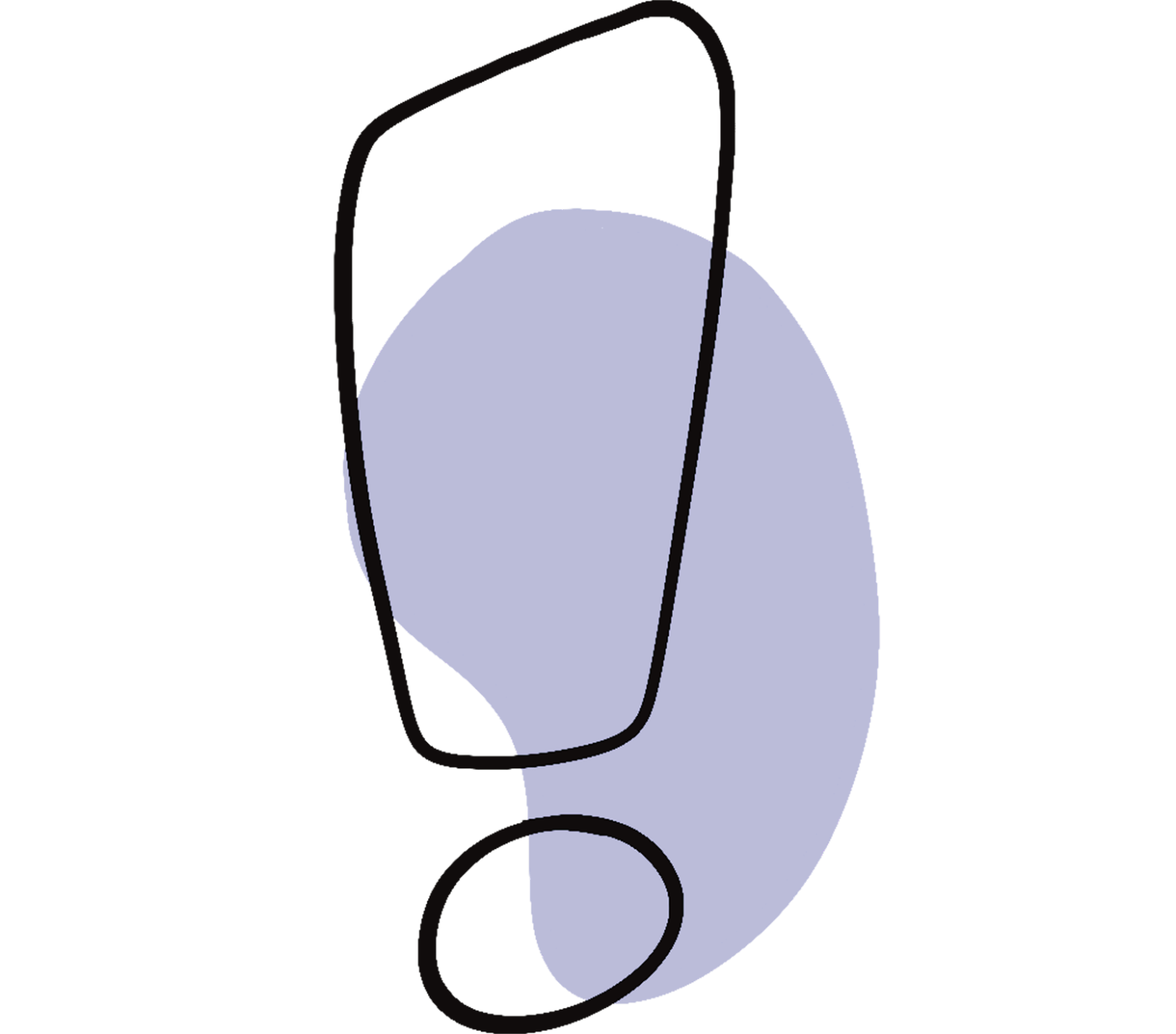
Ein Partizip ist eine Verbform, die eine Mittelstellung zwischen Verb und Adjektiv einnimmt. Hier verhält es sich wie beim erweiterten Infinitiv, und es ist irrelevant, ob das Partizip 1 oder 2 verwendet wird:
Beispiel: „Gerade ein spannendes Buch lesend(,) bemerkte sie nicht, dass es zu regnen begann.“ oder „Gerade ein spannendes Buch gelesen(,) bemerkte sie nicht, dass es zu regnen begann.“
Bei gleichrangigen Adjektiven, die einen aufzählenden Charakter haben, trennst du mit einem Komma. Eine feste Verbindung aus Substantiv und Adjektiv, die durch ein weiteres Attribut näher bestimmt wird, wird jedoch nicht getrennt.
Beispiele: „Ich habe eine Vorliebe für leichte, herbe Rotweine.“ oder „Ich habe eine Vorliebe für dunkles bayerisches Bier.“

Mehrteilige Datums- und Zeitangaben sowie Ortsangaben werden durch Kommata getrennt.
Beispiele: „Sie kommt am Dienstag, den 20. März, um 14.00 Uhr.“ oder „Nürnberg, 9. September.“
Der Gedankenstrich zeigt in erster Linie einen Wechsel an: einen Erwartungswechsel, einen Themenwechsel, einen Sprecherwechsel oder einen Wechsel im Satzbau. Er erzeugt aber auch eine größere Pause als ein Komma, jedoch eine kleinere als ein Punkt.
Beispiele: „Er glaubte sich in Sicherheit – ein verhängnisvoller Irrtum.“ oder „Dieses Bild – es ist das letzte der Künstlerin – wurde vor einigen Jahren nach Amerika verkauft.“
Weshalb ist Interpunktion so wichtig?
Eine gezielte Zeichensetzung gibt Sätzen ihre sinngemäße Struktur und erleichtert das Lesen.
Wird die Interpunktion in einer wissenschaftlichen Arbeit bewertet?
Ja, auch eine korrekte Rechtschreibung und Interpunktion sind Kriterien für die Bewertung einer wissenschaftlichen Arbeit. Lasse deinen Text also am besten von jemandem Korrektur lesen. Du kannst auch KI-basierte Sprachprüfungstools dafür nutzen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.