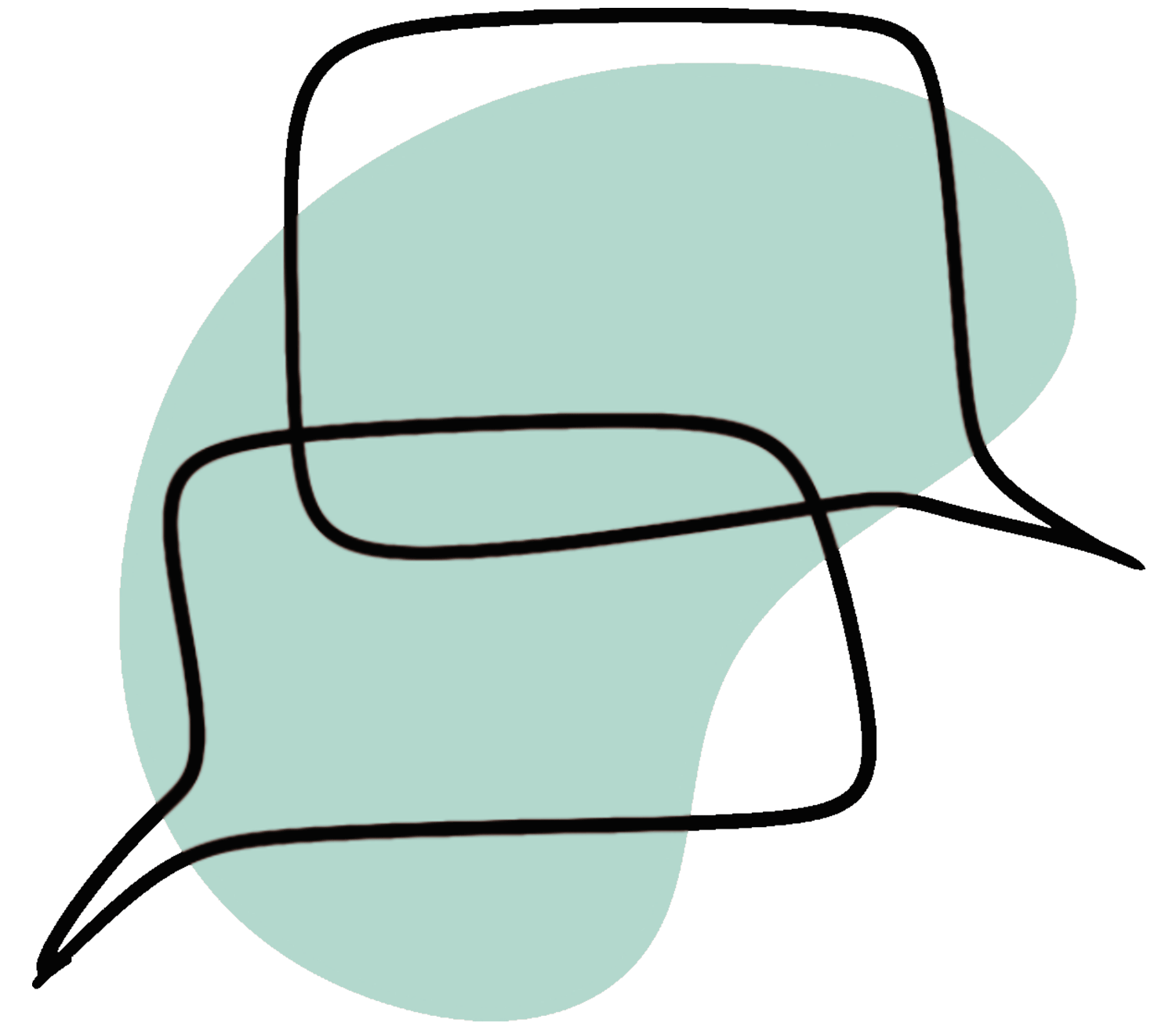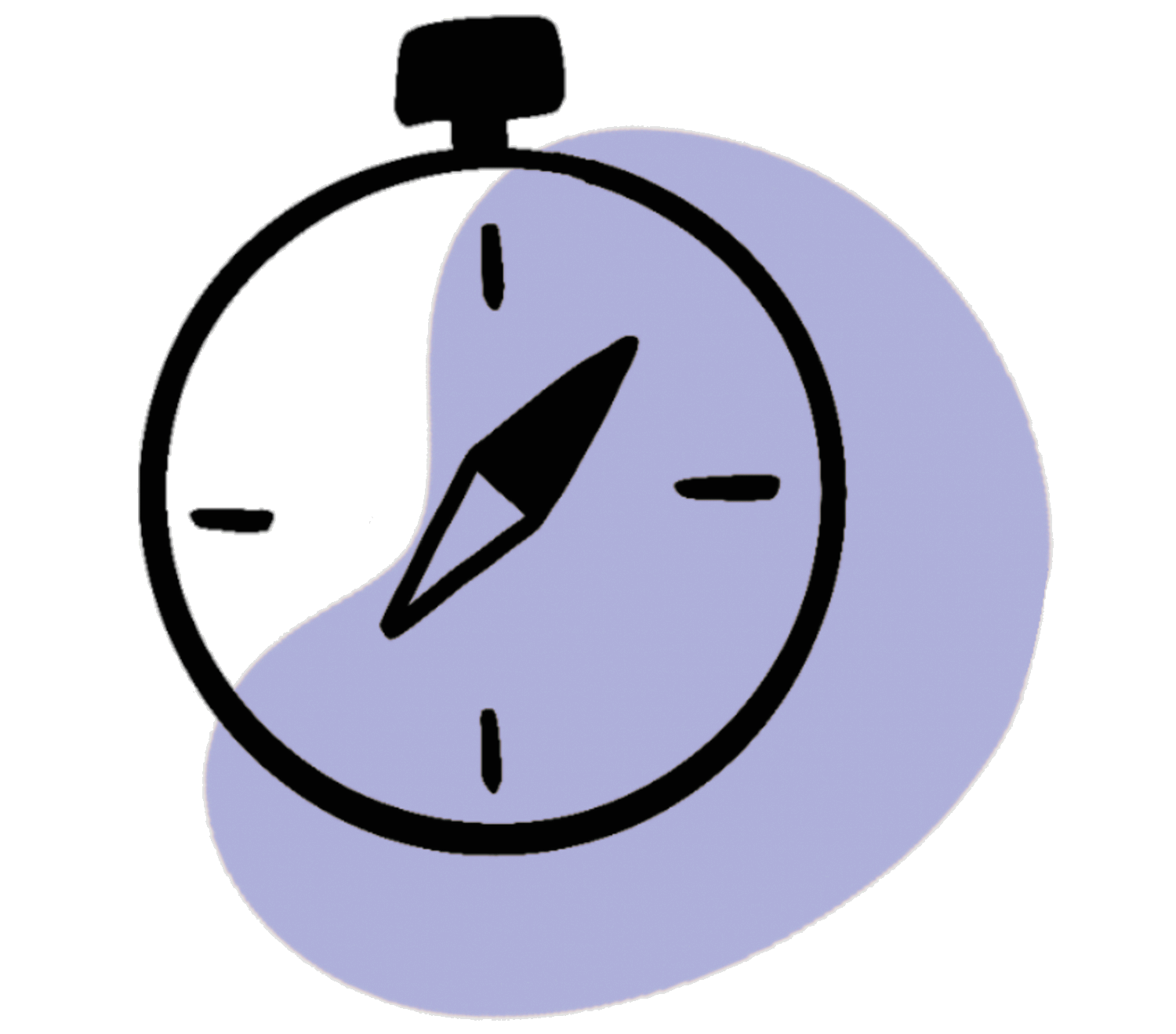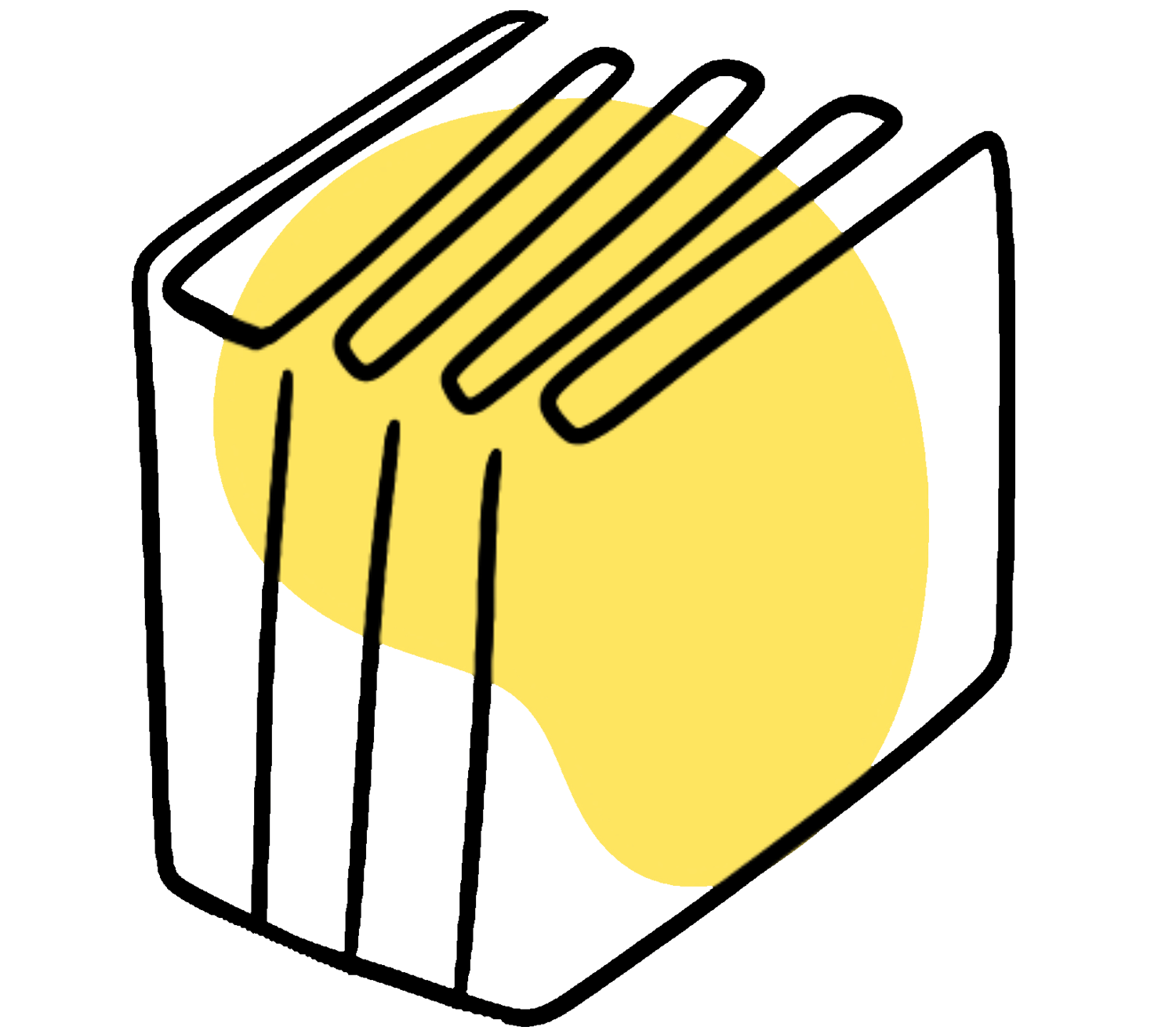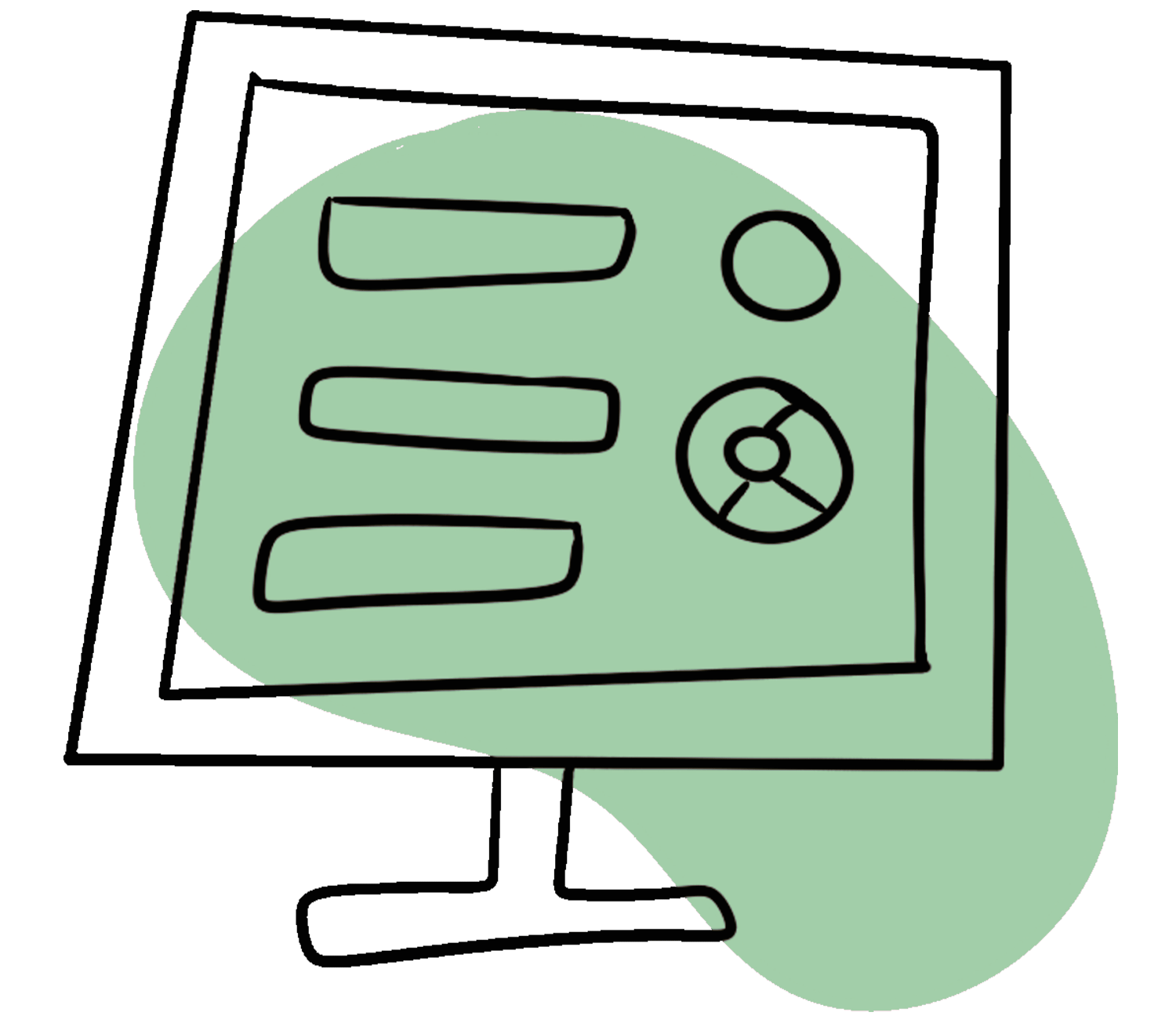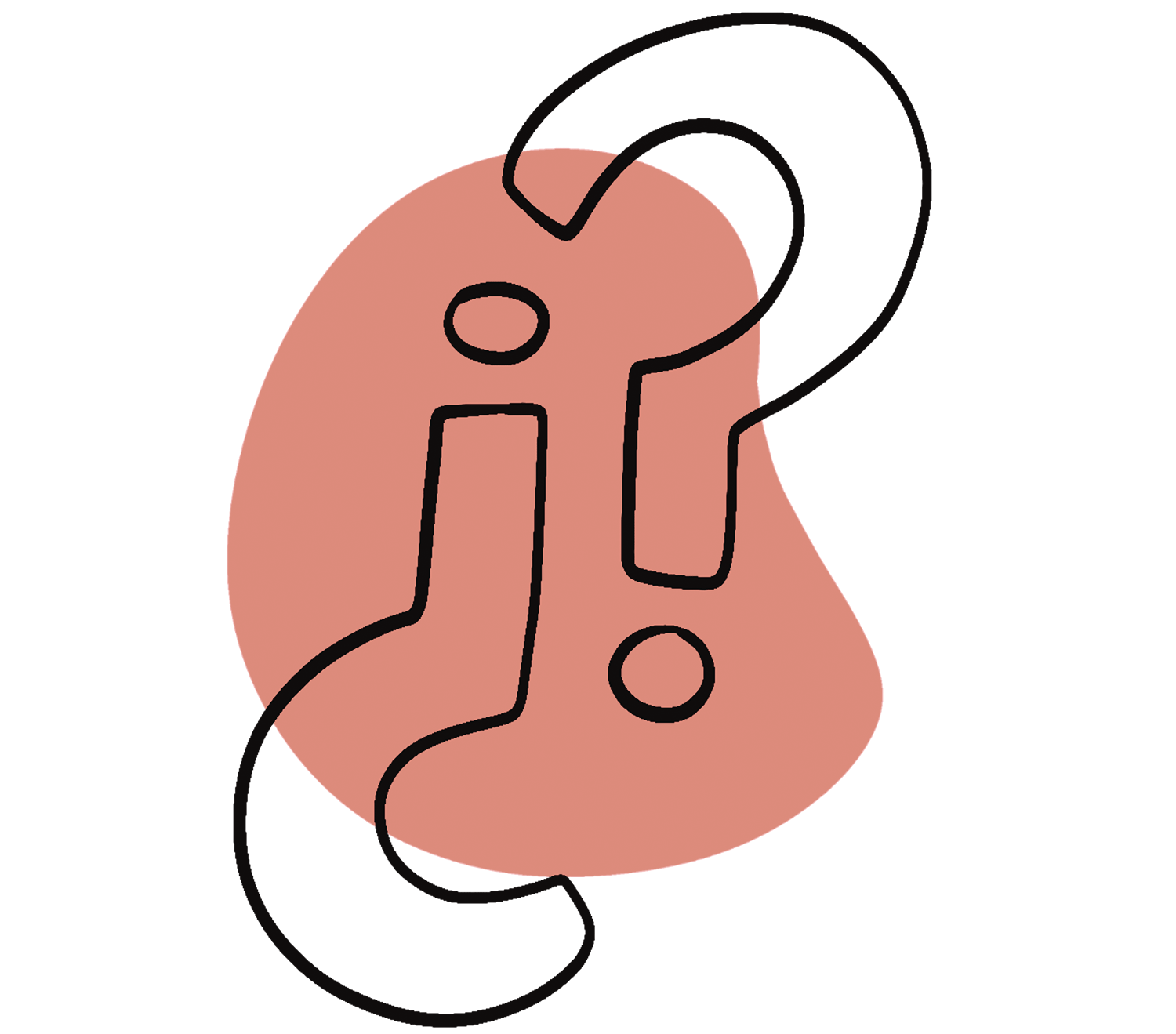- Um Fakten zu belegen: Du gibst an, woher du etwas weißt, und gehst dabei möglichst zur Ursprungsquelle zurück. Damit hältst du dich nicht nur an das Urheberrecht, sondern gibst auch deinen Lesenden die Möglichkeit, sich Methoden etc. genauer anzusehen und nachzurecherchieren.
Beispiel: Mit 90 Prozent ist die Mehrheit der Wikipedia-Autoren männlich (Bayer 2013).
- Um an Vorheriges anzuknüpfen: In der Wissenschaft musst du das Rad nicht stets neu erfinden. Du zitierst, um dich auf Gedanken, Theorien und Ergebnisse von anderen zu beziehen und von hier aus weiterzudenken. So musst du bei deiner Forschung nicht bei Null anfangen.
Beispiel: Der Begriff „Invention“ wird häufig mit den Begriffen „Erfindung“ oder „Entdeckung“ gleichgesetzt (vgl. Müller, 1998, S. 13).
- Um sich kurz zu fassen: Wenn etwas schon woanders steht, genügt es meistens, darauf zu verweisen. In der Wissenschaft kannst du darauf vertrauen, dass dir die Leserschaft entweder glaubt oder sich die Quelle selbst beschafft.
Beispiel: Aufsuchende Hilfen sind ein traditioneller methodischer Ansatz in der Sozialen Arbeit. Jahrhundertelang ermittelten sogenannte Armenpfleger vor Ort die Bedürftigkeit der Menschen, die in Not geratenen waren, und versorgten sie mit Almosen. Sie sollten dabei gleichzeitig die Lebensführung der Armen beaufsichtigen und einen eventuellen Missbrauch der Hilfeleistungen verhindern (vgl. ausführlich Sachße/Tennstedt 1980).
Häufig erfüllen Zitate auch mehrere Funktionen gleichzeitig:
Beispiel: Im Hinblick auf die Nutzung von Meereswärme zur Stromerzeugung konzentrierten sich Forschungsarbeiten zu Strukturrohren zwischen 1970 und 2000 auf die Verwendung von Wasser als Wärmeträger. Gemessen wurde der Wärmeübergang und Widerstandsbeiwerte von Strukturrohren [6–17]. Weitere Messungen mit Wasser wurden von Unternehmen [18, 19] durchgeführt. Wenige Arbeiten untersuchten auch Gase als Wärmeträger [11, 20].
Es gibt zwei Arten von Zitaten: direkte und indirekte. Bei beiden fügst du immer einen Beleg an, um zu zeigen, woher das Zitat stammt.
Bei direkten Zitaten übernimmst du den fremden Text unverändert. Dies machst du durch Anführungsstriche und den Beleg deutlich.
Beispiel: „Einer der wesentlichen Wegbereiter dieses Modells ist Goffman mit seinem Konzept des Stigmas bzw. der Stigmatisierung“ (Metzler, 2011, S. 101).
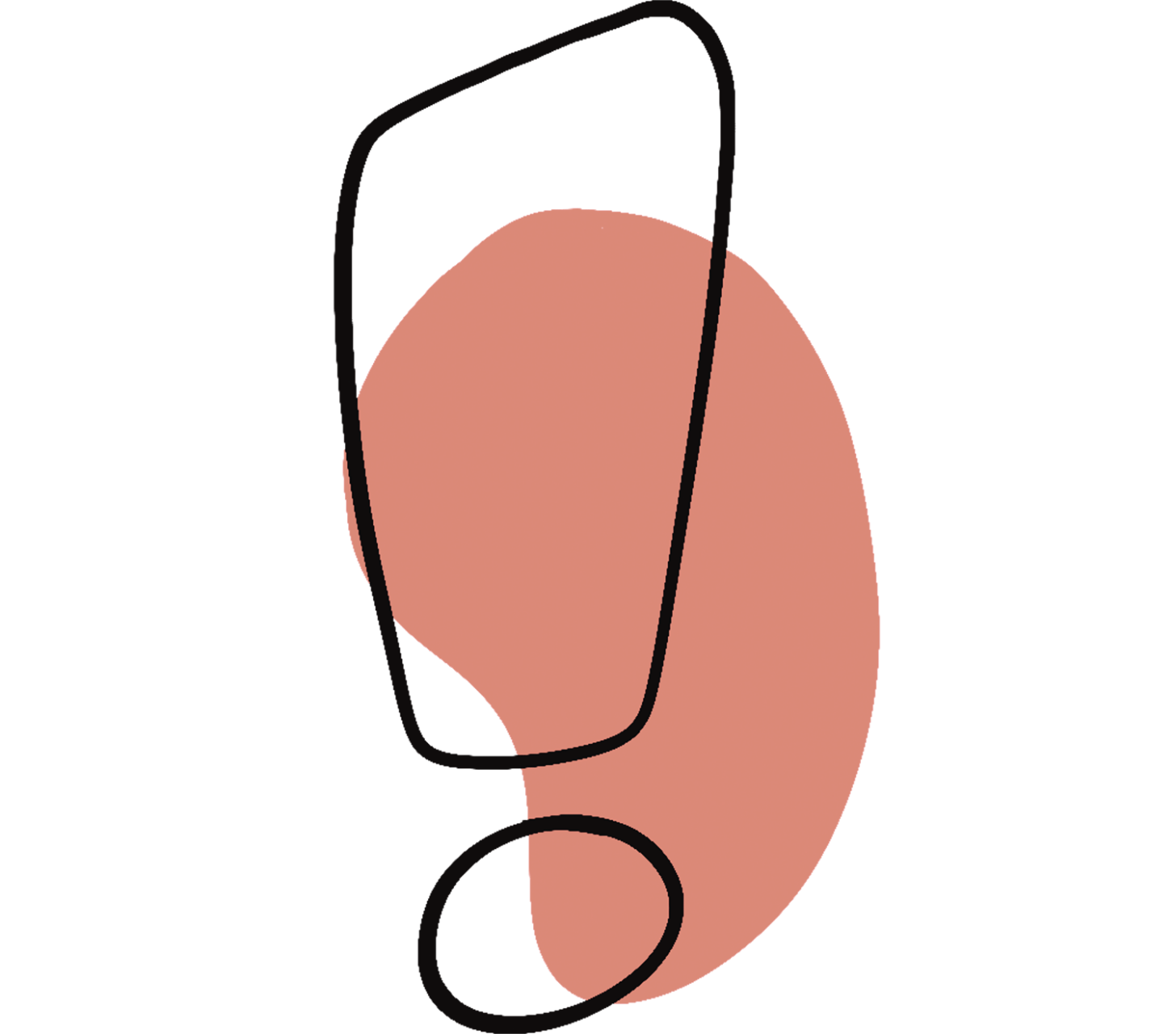
Bei indirekten Zitaten übernimmst du Gedanken, Ergebnisse etc. aus den Texten anderer, formulierst sie aber in eigenen Worten. Auch indirekte Zitate werden mit einem Beleg markiert.
Beispiel: Nach Metzler gehört Goffmann, der das Konzept des Stigmas bzw. Stigmatisierung entwickelte, zu den wichtigen frühen Vertretern des symbolischen Interaktionismus (2011, S. 101).
In wissenschaftlichen Texten gibt es viele verschiedene Arten zu zitieren. Fußnoten, Klammern im Text mit dem Naben der Autorinnen und Autoren und der Jahreszahl, Nummern oder Kombinationen aus Ziffern und Buchstaben in eckigen Klammern.
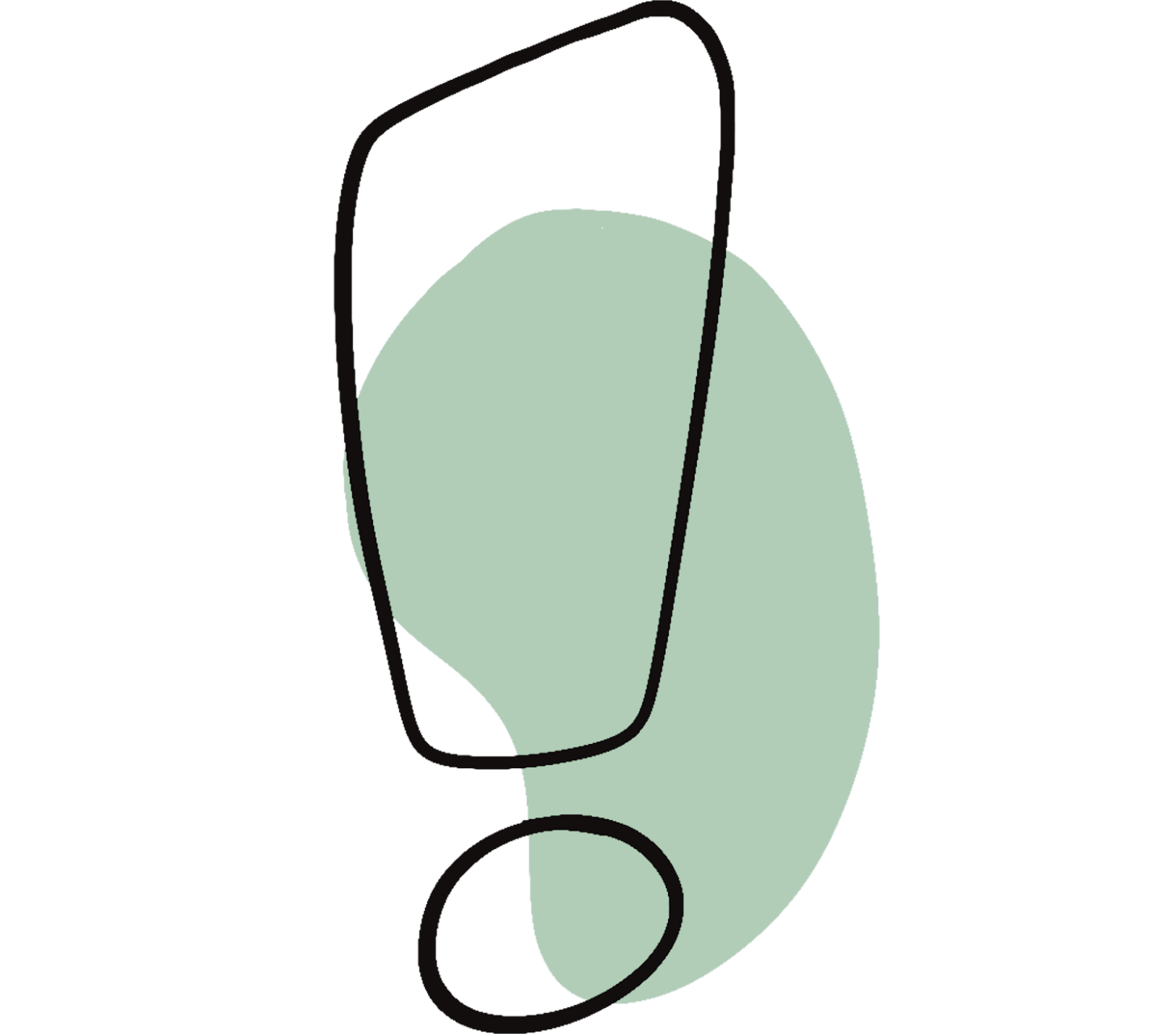
Woher weiß ich, welchen Zitierstil ich wählen soll?
- Frage deinen Dozenten oder deine Dozentin. Häufig haben Lehrende einen bevorzugten Zitierstil, an den du dich halten solltest.
- Informiere dich über die Konventionen in deinem Fach. Siehe dazu unsere Artikel: Zitieren in den Sozialwissenschaften, Zitieren in der Betriebswirtschaft, Zitieren in den Ingenieur- und Naturwissenschaften.
- Wenn dir von Seiten der Lehrenden keine Vorgaben gemacht werden, darfst du dich selbst für einen entscheiden. Folge am besten einem Stil, der gut dokumentiert ist (DIN, Harvard, APA, IEEE etc.).
Im Literaturverzeichnis führst du alle Quellen auf, die du in deinem Text zitiert hast – und nur diese. Das Literaturverzeichnis soll den Lesenden ermöglichen, die angegebenen Quellen nachzuvollziehen. Die Angaben müssen also so detailliert sein, dass die Lesenden die Quelle eindeutig zuordnen und ggf. selbst beschaffen können.
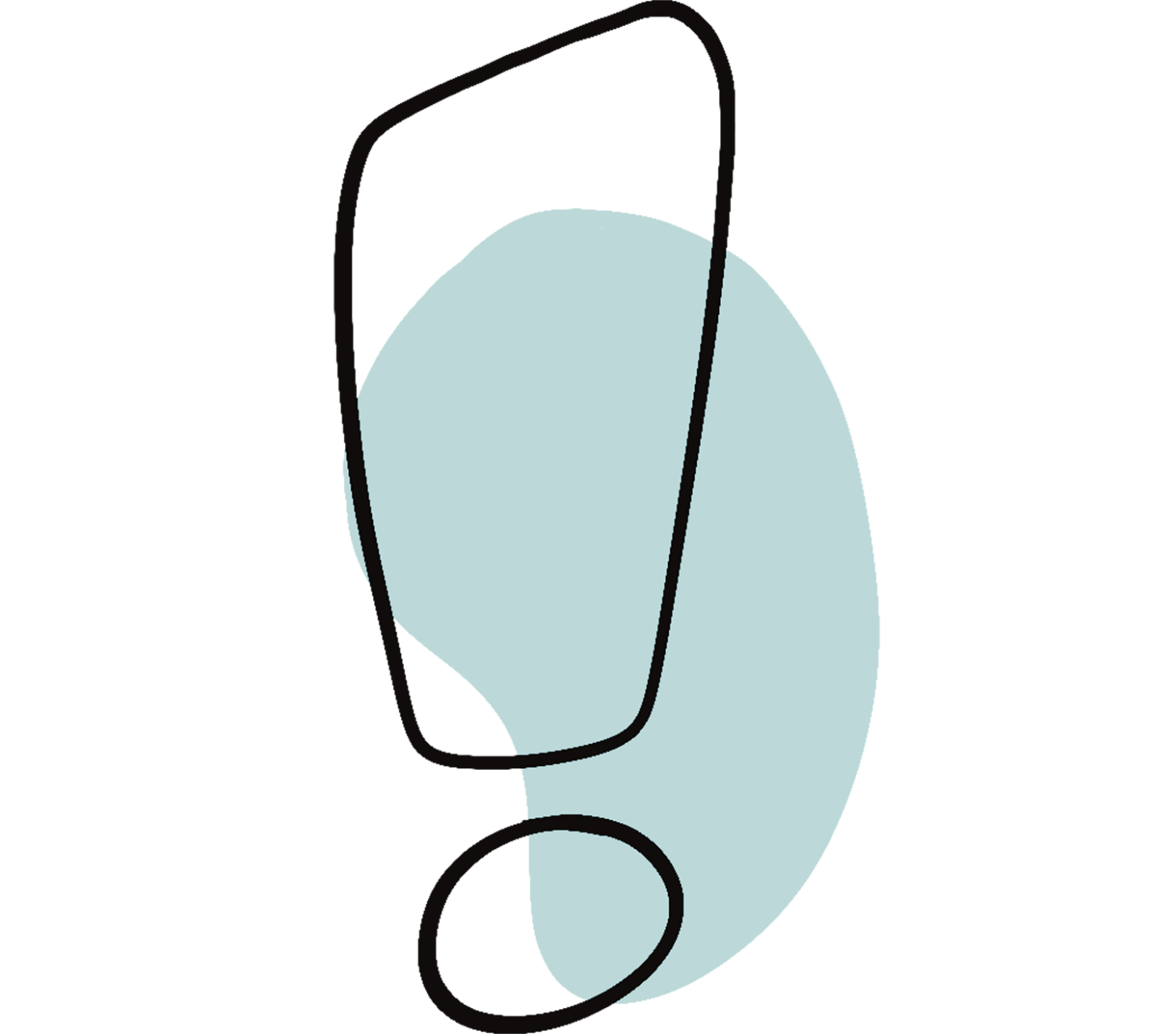
Wie das Literaturverzeichnis aussieht, hängt von dem gewählten Zitierstil ab. In der Regel sind die Quellen alphabetisch geordnet.
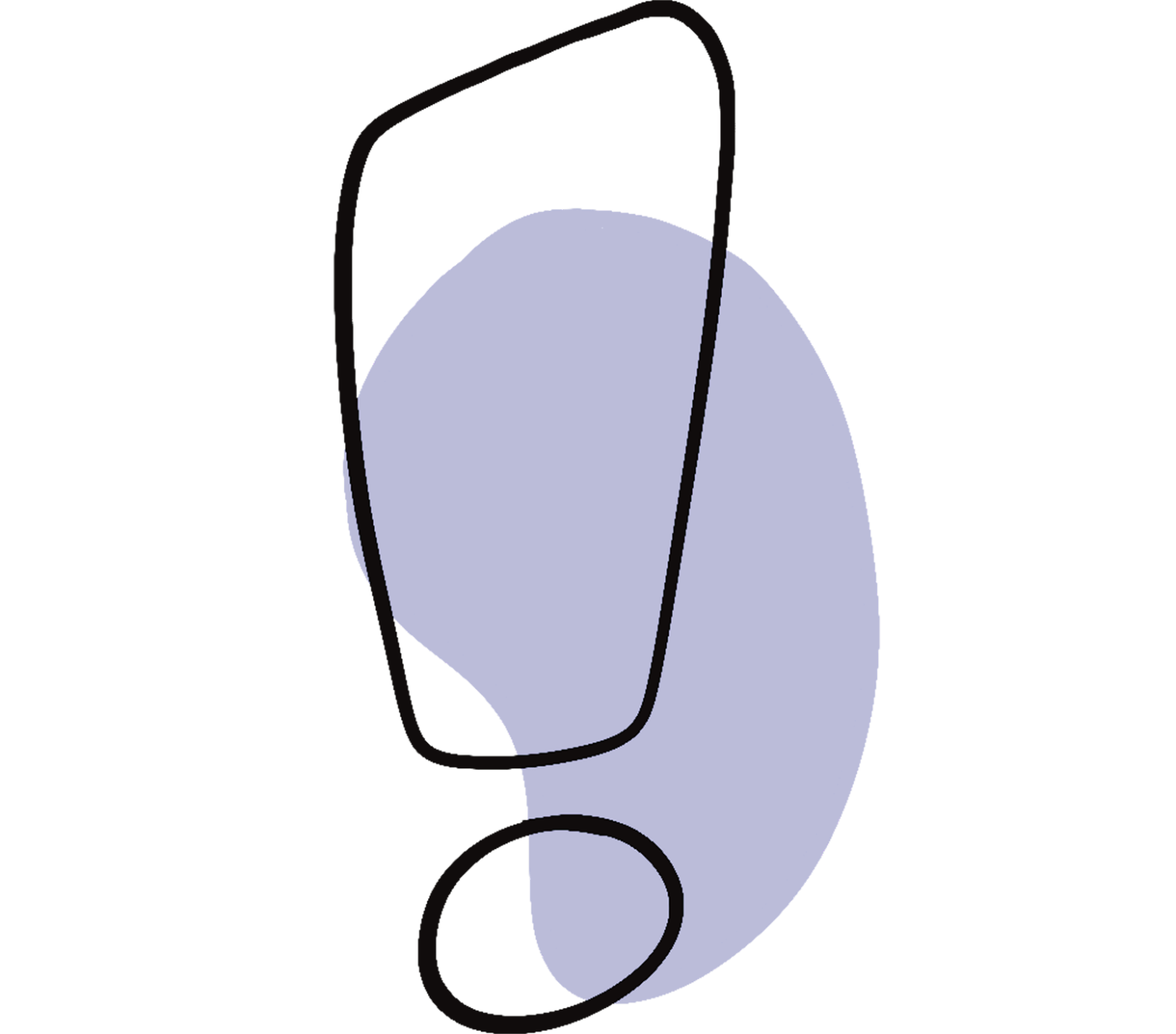
Das klingt einfacher als es ist. Gerade am Anfang des Studiums ist es schwer, allgemeines Wissen im Fach zu identifizieren. Vielleicht tröstet es dich, dass es mit der Zeit einfacher wird, zu unterscheiden, wann ein Zitat nötig ist und wann nicht. Bis dahin können dir folgende Daumenregeln helfen:
Das musst du nicht unbedingt zitieren:
- Etwas, das Leser und Leserinnen ohnehin schon wissen.
- Was der gesunde Menschenverstand sagt.
- Wenn es in allgemeinen Lexika steht.
Das musst du unbedingt zitieren:
- Wenn sich der Gedanke oder das Ergebnis auf bestimmte Autorinnen und Autoren oder eine Studie zurückführen lässt.
- Wenn es sich um eine umstrittene Aussage handelt.
- Etwas, das du wortwörtlich übernimmst.
- Wenn du Zahlen aus der Forschung anderer angibst.
Wie zitiere ich richtig?
Um richtig zu zitieren, gibst du die verwendete Quelle sowohl an der genauen Stelle im Text als auch im Literaturverzeichnis an.
Wie zitiere ich im Text?
Für die Zitation im Text gibt es unterschiedliche Zitierstile. Wichtig ist, dass du innerhalb eines Textes einheitlich vorgehst und den Vorgaben folgst.
Was genau bedeutet zitieren?
Zitieren bedeutet, dass du eine Stelle aus einem Text wörtlich oder inhaltlich übernimmst. In wissenschaftlichen Texten ist es üblich, diese so zu markieren, dass der Originaltext nachvollziehbar ist.
Was muss ich alles zitieren?
Zitiere immer dann, wenn du Formulierungen oder Ideen aus fremden Texten übernimmst. Grundlegendes Wissen im eigenen Fach musst du nicht als Zitat kennzeichnen.
Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.